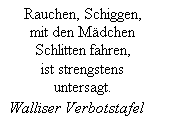
Die antinominalistische Einsicht, daß das Wallis weit über die Franzosenzeit hinaus keine bürgerliche Gesellschaft zu werden vermochte, begünstigt ein schnelles Abbremsen der Suche nach Spuren von Kunst in ihr: das Bauernleben erlaubt keine, das Kirchenleben absorbiert sie in seinem graumäusigen dogmatisch-populistischen Theoriehorizont, und die Aristokratie, die selbst auch nie recht sich hat ausbilden können, hat launisch keine je begünstigt. Doch auch wenn die Kunst des Schreibens wesentlich mit dem Bürgertum zu konnotieren wäre, muß in einer Gesellschaft, die heute mit allen grenzüberschreitenden Netzen sich verknüpft, die Frage in der penetranten Radikalität gestellt werden, wieso das Wallis keinen Joyce hervorgebracht hat, der vielleicht gerade insbesondere im sogenannten Ausland zu wirken vermöchte. Denn wird das Schreiben nicht bloß als Handwerk, das zu Produkten führt, die in der Freizeit konsumiert werden können, sondern streng als Kunst verstanden, muß in seiner Geschichte ein Verhältnis zur Sprache als Material nachzeichenbar sein. Da diese Geschichte des schriftsprachlichen Materials bei Joyce und in abgewandelter, gemäßigter Manier bei Arno Schmidt ihren Höhepunkt gefunden hat, muß selbst in der kulturell abgedrängten Gletscherlandschaft des Wallis das künstlerische Schreiben in einen Bezug zu den avanciertesten Autoren gesetzt werden; nur dann wäre solches deplaziert, wenn das Schreiben sich gar nicht trauen würde, einen künstlerischen Anspruch zu erheben. Doch obwohl es nicht nur als möglich sondern notwendig erscheint, die Produkte der Kunst dem allgemeinen geschichtlichen Niveau gegenüberzustellen, sind gewisse Momente im materiellen Raum ihres Entstehens streng ins Auge zu fassen: die endogenen Zwänge des Provinziellen. Wird in der globalisierten Moderne, die darauf zielt, selbst im hintersten Krachen die neuesten Standards gleich welcher Technologien durchzusetzen, dem Begriff der kulturellen Provinz eine Bedeutung zugedacht, so besteht sie darin, in ihr selbst a) keine spürbare Leserschaft hervorzubringen, b) keine gesellschaftliche Dynamik zuzulassen, c) keine normative Kritik freizusetzen, die auf schlechte Prozesse Einfluß nehmen könnte, letztlich d) jedes Umfeld der Kritik im Keim zu ersticken, da, wo sie an das persönliche Leben noch gebunden erscheint. Die Walliser Schreibkunst verstehen zu wollen heißt dann nichts anderes als darzustellen, wie Kritik in dieser Kunst noch nichts Selbstverständliches geworden ist.
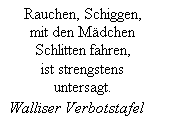
Man muß als erstes für eine gewisse historische Übergangszeit Platz schaffen, von der man nicht weiß, wo sie beginnt und wo endet, ebenso wenig, welche Gattungen sie enthält oder streift. Zu denken sind an die Akten der Gerichte, der Gemeinden und Notariate, des Bistums und der Pfarreien. Obwohl die Hauptmasse dieser Akten formelle Funktionen erfüllt, sind Exponate mit subjektiven Darstellungen gewißlich mit enthalten: Verteidigungen und Schuldbestreitungen, Anklagen und Denunziationen, Briefe, Tagebücher, Familienchroniken, Autobiographien, ausformulierte Testamente usw.
Die Formation der ernsten Schriftsteller ist nun leicht in ein Schema einzupassen: auf ein erstes Duo, Fux und Zermatten, dessen eine Hälfte französisch schreibt, die andere deutsch, folgt ein zweites mit derselben sprachlichen Aufteilung, Imhasly und Chappaz. Unter den Randständigen, auf die hier nicht eingegangen wird, gibt es Größen, die den Genannten nicht nachstehen, wie Chappaz‘ Frau S. Corinna Bille, aber auch solche, die eine gewisse, zumindest nationale Berühmtheit erlangt haben, deren Wirken aber doch mehr aufs Leben selbst bezogen gesehen werden sollte, etwas larmoyant die Evolener Lehrerstochter Marie Métrailler, recht anregend die gescheite Hebamme Adeline Favre, die nichts mehr mit den zwielichtigen, mystifizierten anniviardischen „Weisen Frauen“ gemein hat. (Weitere Namen in Ecrivains valaisans 1984.)

Das Arbeitsfeld des Försters Fux rechts unterhalb des Glishorns.
Im Hintergrund das Folluhorn mit Rosswald, darunter Brig. (10.3.1998)
Sieglinde Gertschen beschreibt in Fux 1984 aufschlußreich das Verhältnis der Generation der jetzt 40jährigen zu Adolf Fux, dem ersten Walliser Schriftsteller, 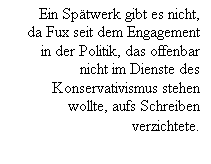 Sohn des letzten Kutschers, angestellter Förster, gewählter Stadtpräsident von Visp und Kantonspolitiker. Obwohl Fux aus der bloß nächst
älteren Generation stammte und weniger als zehn Kilometer weit entfernt seinen Wohnsitz hatte, blieb er der einheimischen Philosophin sehr lange unbekannt, und der erste Lektürestoß mag wohl viel Unbehagen ausgelöst haben, zumal im Zusammenspiel mit der Verpflichtung, die Texte zwecks Publikationsauswahl verbindlich zu beurteilen. Denn was Fux‘ Werk im ganzen bestimmt, ist eine
Heterogenität sowohl auf den Ebenen der Ideologie und der Ästhetik wie des Rhetorisch-Stilistischen. Recht befremdend mutet im Frühwerk insgesamt, aber auch in einzelnen kleinen Passagen des reifen Künstlers eine verquere, dümmliche Blut & Boden-Stimmung an. Solcher Ästhetik, die weniger einer politischen Reflexion geschuldet wird denn als kaum zu erstaunender Effekt des
anpasserischen Künstlerwillens in der Provinz zu sehen ist, dem die Möglichkeiten der Erfahrung von Kunst nicht gegeben waren, stehen die weitaus umfangreicheren Texte und Textteile gegenüber, die ein recht lebendiges Bild des Alltags im Oberwallis des frühen 20. Jahrhunderts vermitteln. Fast alle Geschichten, seien sie der Tendenz nach im Einzelfall ein Roman oder eine Short Story,
sind der einen Grundfrage gewidmet nach dem Spannungsfeld zwischen dem traditionalen Bergbauernleben und den ökonomistischen Anforderungen des Kapitalismus. Indem Fux in den avanciertesten Texten nicht a priori die Werte der alten Gesellschaft glorifiziert, wird nicht nur Raum geschaffen für realistische Fragestellungen, sondern die Darstellungen im Gesamten und im Detail werden
realistischer, reich im Literarischen und im Gehalt. Allerdings ist eine Grenze in der Einschätzung da zu machen, wo die Texte als die Dokumente bereits der Geschichte zu nehmen wären, wie der Volkskundler Niederer meint. Denn werden den Geschichten von Fux die vielen zeitgenössischen Bilder gegenübergestellt, wie sie bekanntlich in unzähligen Büchern aus dem Wallis wiedergegeben
werden, verblassen auch Fuxens starke Passagen vor dem Informationsgehalt der bloßen Fotografien, der eben immer schon der Ansporn war, sie auch in heiklen Situationen zu realisieren – den Werken des Belletristikers dagegen ist ein spontaner Psychologismus vorgelagert, der angesichts realistischer Anforderungen zu sehr zögert, strukturelle Zusammenhänge, innerhalb welchen die
Geschichten passieren, auszuformulieren.
Sohn des letzten Kutschers, angestellter Förster, gewählter Stadtpräsident von Visp und Kantonspolitiker. Obwohl Fux aus der bloß nächst
älteren Generation stammte und weniger als zehn Kilometer weit entfernt seinen Wohnsitz hatte, blieb er der einheimischen Philosophin sehr lange unbekannt, und der erste Lektürestoß mag wohl viel Unbehagen ausgelöst haben, zumal im Zusammenspiel mit der Verpflichtung, die Texte zwecks Publikationsauswahl verbindlich zu beurteilen. Denn was Fux‘ Werk im ganzen bestimmt, ist eine
Heterogenität sowohl auf den Ebenen der Ideologie und der Ästhetik wie des Rhetorisch-Stilistischen. Recht befremdend mutet im Frühwerk insgesamt, aber auch in einzelnen kleinen Passagen des reifen Künstlers eine verquere, dümmliche Blut & Boden-Stimmung an. Solcher Ästhetik, die weniger einer politischen Reflexion geschuldet wird denn als kaum zu erstaunender Effekt des
anpasserischen Künstlerwillens in der Provinz zu sehen ist, dem die Möglichkeiten der Erfahrung von Kunst nicht gegeben waren, stehen die weitaus umfangreicheren Texte und Textteile gegenüber, die ein recht lebendiges Bild des Alltags im Oberwallis des frühen 20. Jahrhunderts vermitteln. Fast alle Geschichten, seien sie der Tendenz nach im Einzelfall ein Roman oder eine Short Story,
sind der einen Grundfrage gewidmet nach dem Spannungsfeld zwischen dem traditionalen Bergbauernleben und den ökonomistischen Anforderungen des Kapitalismus. Indem Fux in den avanciertesten Texten nicht a priori die Werte der alten Gesellschaft glorifiziert, wird nicht nur Raum geschaffen für realistische Fragestellungen, sondern die Darstellungen im Gesamten und im Detail werden
realistischer, reich im Literarischen und im Gehalt. Allerdings ist eine Grenze in der Einschätzung da zu machen, wo die Texte als die Dokumente bereits der Geschichte zu nehmen wären, wie der Volkskundler Niederer meint. Denn werden den Geschichten von Fux die vielen zeitgenössischen Bilder gegenübergestellt, wie sie bekanntlich in unzähligen Büchern aus dem Wallis wiedergegeben
werden, verblassen auch Fuxens starke Passagen vor dem Informationsgehalt der bloßen Fotografien, der eben immer schon der Ansporn war, sie auch in heiklen Situationen zu realisieren – den Werken des Belletristikers dagegen ist ein spontaner Psychologismus vorgelagert, der angesichts realistischer Anforderungen zu sehr zögert, strukturelle Zusammenhänge, innerhalb welchen die
Geschichten passieren, auszuformulieren.

Maurice Zermattens Geburtsort und Lebenswelt im Val d’Hérens: St-Martin. (27.10.1998)
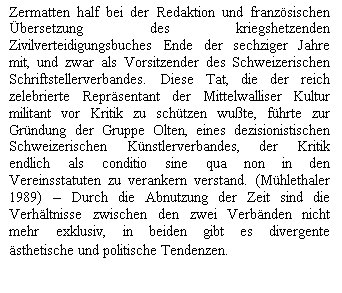 Sehr weit entfernt von einem realistischen Ansatz hat sich Maurice Zermatten festgeschrieben. Politisch nun aufstoßend nah dem Rechtskonservativismus, verabschiedet er sich ästhetisch so entschieden von der Realität, daß die Bilder sowohl der agierenden Subjekte wie der Landschaft nicht mehr nachvollziehbar werden:
Konnten bei Fux die Lokalitäten auch ohne Nennung der Ortschaftsnamen in den meisten Fällen identifiziert werden, entsteht bei Zermatten der überaus zermürbende Eindruck, es müsse wohl die Walliser Bevölkerung vor jeder Verbindlichkeit geschützt werden, indem nie ein Ort des Geschehens auch mit der wirklichen Landschaft korrespondiert. Es ist ein hartes Stück, wie das
institutionelle Wallis einen Autor zu favorisieren vermag, der in keinem literarischen Text wirklich auf die Walliser Landschaft sich bezieht. Doch ist es nicht nur das unredliche Schildern der Landschaft, das in kruden Holzschnittreliefs jedes Phantasieren vor den Kopf stößt, sondern es werden auch die Personen der Stücke wie leblose Schemen in eine Konstellation gesetzt, wo wenig
nur vom Walliser Leben herauszuspüren möglich ist, viel aber vom dumpfen
Sehr weit entfernt von einem realistischen Ansatz hat sich Maurice Zermatten festgeschrieben. Politisch nun aufstoßend nah dem Rechtskonservativismus, verabschiedet er sich ästhetisch so entschieden von der Realität, daß die Bilder sowohl der agierenden Subjekte wie der Landschaft nicht mehr nachvollziehbar werden:
Konnten bei Fux die Lokalitäten auch ohne Nennung der Ortschaftsnamen in den meisten Fällen identifiziert werden, entsteht bei Zermatten der überaus zermürbende Eindruck, es müsse wohl die Walliser Bevölkerung vor jeder Verbindlichkeit geschützt werden, indem nie ein Ort des Geschehens auch mit der wirklichen Landschaft korrespondiert. Es ist ein hartes Stück, wie das
institutionelle Wallis einen Autor zu favorisieren vermag, der in keinem literarischen Text wirklich auf die Walliser Landschaft sich bezieht. Doch ist es nicht nur das unredliche Schildern der Landschaft, das in kruden Holzschnittreliefs jedes Phantasieren vor den Kopf stößt, sondern es werden auch die Personen der Stücke wie leblose Schemen in eine Konstellation gesetzt, wo wenig
nur vom Walliser Leben herauszuspüren möglich ist, viel aber vom dumpfen 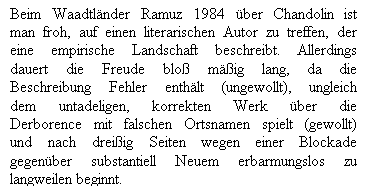 Gesumse katholischer Glaubensfragen das Gemüt der Lesenden quält, wie sie auch an andern Orten der Erde die Menschen am Denken behindern wollen. Man muß sich zwar sehr vorsichtig, aber um nichts weniger entschieden vorwärts bewegen. Obwohl Zermattens Wirkungsradius nicht groß erscheinen mag und eine eigentliche
Wiederentdeckung kaum zu befürchten ist, müssen im
Gesumse katholischer Glaubensfragen das Gemüt der Lesenden quält, wie sie auch an andern Orten der Erde die Menschen am Denken behindern wollen. Man muß sich zwar sehr vorsichtig, aber um nichts weniger entschieden vorwärts bewegen. Obwohl Zermattens Wirkungsradius nicht groß erscheinen mag und eine eigentliche
Wiederentdeckung kaum zu befürchten ist, müssen im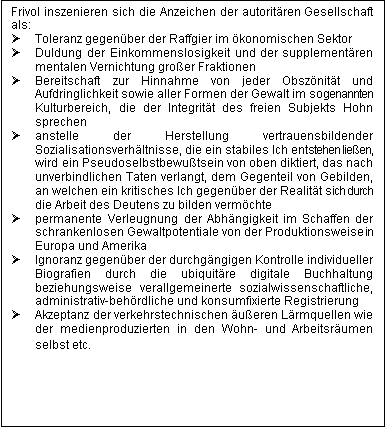 Angesicht so vieler Anzeichen des erneuten sich Breitmachens einer autoritären Gesellschaft weltweit alle deutbaren, also ins Gedächtnis eindringenden Gebilde, die autoritäre Bestrebungen wenn nicht favorisieren so doch fahrlässig dulden, in der Weise in den kulturellen Diskurs gleich welcher Art eingebunden werden,
daß die kritischen Potentiale der tätigen Vernunft weder eingeschläfert, zu Boden gedrückt noch – wie es das gängige Vorgehen der Kulturindustrie auszeichnet – durch die Masse undeutbarer Kleinstgebilde zugeschüttet wird. Wenn auch ein kritischer Diskurs über die Werke Maurice Zermattens nicht möglich ist, weil zu wenige realistische Momente in ihnen enthalten wären, die
sich transformieren ließen, kann das Normative im zornigen künstlerischen Urteilen doch dazu führen, daß neue AutorInnen Wege auf sich nehmen, die weder von den gesamtgesellschaftlichen globalen Anforderungen und Herausforderungen sich abwenden noch die scheinbar kleineren, die das scheinbar provinzielle Wallis vor der Zerstörung von außen hütete, links liegen lassen.
Angesicht so vieler Anzeichen des erneuten sich Breitmachens einer autoritären Gesellschaft weltweit alle deutbaren, also ins Gedächtnis eindringenden Gebilde, die autoritäre Bestrebungen wenn nicht favorisieren so doch fahrlässig dulden, in der Weise in den kulturellen Diskurs gleich welcher Art eingebunden werden,
daß die kritischen Potentiale der tätigen Vernunft weder eingeschläfert, zu Boden gedrückt noch – wie es das gängige Vorgehen der Kulturindustrie auszeichnet – durch die Masse undeutbarer Kleinstgebilde zugeschüttet wird. Wenn auch ein kritischer Diskurs über die Werke Maurice Zermattens nicht möglich ist, weil zu wenige realistische Momente in ihnen enthalten wären, die
sich transformieren ließen, kann das Normative im zornigen künstlerischen Urteilen doch dazu führen, daß neue AutorInnen Wege auf sich nehmen, die weder von den gesamtgesellschaftlichen globalen Anforderungen und Herausforderungen sich abwenden noch die scheinbar kleineren, die das scheinbar provinzielle Wallis vor der Zerstörung von außen hütete, links liegen lassen.
Am Ende des Absorptionszweigs der Kunst durch die institutionalisierte Frömmigkeit und am zögerlichen Anfang der aufklärerischen Moderne, präsent sonst allein durch den auftrumpfenden Positivismus in der Verwaltung, sind die Werke von Maurice Chappaz und die eigenen seines Übersetzers Pierre Imhasly Beweis für den Kunstwillen sowohl im französischsprachigen wie im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis. Es ist verschiedenes, das die Werke dieser Künstler von Fux und Zermatten trennt, entscheidend aber ist, daß nicht mehr nur Texte wie Literatur aus der großen Welt hergestellt werden, sondern als eigenständiger Eingriff in dieselbe zu verstehen sind. Chappaz und Imhasly sind weniger Walliser, die auch schreiben, sondern genuine Kunstschaffende, deren Sozialisation zwar im Wallis geschehen ist, deren Blick auf die Welt durch die eigenen Werke das Wallis aber bloß nur noch streifen soll, als supplementäres Moment zu solchen, die zumindest die kulturellen Fesseln der Herkunftsgesellschaft abstreifen wollen. Es ist trivial, daß da, wo das Selbstverständnis der Kunst im Willen zur Kunst eine eindeutige, motivierende Grundlage gefunden hat, die Kritik dadurch ernster wird, daß sie mehr sich in den Werken immanent bewegt statt äußerlich nur Gesamteindrücke anzudeuten. Was denn vom Innersten ihrer Werke an den Tag zu schaffen wäre, ist, gemäß der Eingangsbehauptung, Zeugnis dafür, daß dem Wallis ein Neues, das durch Selbstkritik ausgezeichnet wäre, nicht wie anderswo leichtfüßig sich breitmachen zu können scheint. Das Vorgehen, das zu zeigen ist und das beiden Dichtern eignet, ist nur zu leicht zu formulieren: Wie der Walliser Gesellschaft die vermittelnden Institutionen fehlen, gehen die Dichter dem prosaischen Benennen aus dem Weg, um der empfundenen Stimmung verdichtet und abgedichtet, offenbar mit dem Zweck der Reinheit beziehungsweise Klarheit und künstlerischen Radikalität, Ausdruck zu geben.
Fehlt bei Zermatten wegen der Holzschnittartigkeit des Verfahrens die Stimmung ganz, versäuft das Lesen bei Chappaz zuweilen in ihr, verführt es in einzelnen Passagen gar in Überdruß, weil zu wenig rational-argumentative Momente den Text steuern. Es erwächst dann der Verdacht, was Chappaz kritisieren möchte sei noch zu sehr unbearbeitetes, zu wenig diskutiertes Ressentiment, das vorschnell Disparates in denselben einzigen Topf wirft: alles ist schlecht im Land. Auf infame Weise wurde dem Dichter in den sechziger und siebziger Jahren landesweit in den Medien der Prozeß gemacht, weil er die Landschaft durch Kritik in schlechten Ruf zu bringen trachte und destabilisieren würde. Doch liest man den unmittelbaren Anlaß heute, Die Zuhälter des ewigen Schnees. Ein Pamphlet, reibt man sich die Augen weniger über die nur schwach aufmüpfige Unbotmäßigkeit, sondern die Zurückhaltung im Benennen. Was zur Sprache gelangt, ist ein Gefühl, das sowohl Innerhalb der Grenzen des Wallis wie außerhalb in breiten Gesellschaftsschichten längstens Platz gefunden hatte: daß die Investitionen in die touristische Infrastruktur allenthalben außer Kontrolle geraten waren, weil die Infrastruktur beginnt, weniger einem gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu dienen als einzelnen, die Demokratie arg strapazierenden Individuen die Säcke zu füllen und wegen des Unterlaufenwerdens demokratischer Entscheidungsprozesse den Tourismus in einen Zustand zu führen, der sowohl der Natur wie der Gesellschaft schadet, die in jener über die Perioden der touristischen Hochsaisons hinaus ein Leben zu gestalten hat. Wenn denn die Niederträchtigkeit der Angriffe auf den Dichter einen Nutzen gehabt haben soll, dann den, daß Chappaz nicht mehr nur im französischen Sprachraum ein öffentlich ernst zu nehmender Diskussionspartner geworden war, sondern, vermittelt durch den Übersetzer Imhasly, auch im gesamten deutschsprachigen, wodurch die Tourismuskritik zwar noch längst nicht sich im gebotenen Maße institutionalisieren doch komfortabel unterfüttern ließ.

Prägte nicht nur Chappaz: Internatsstädtchen St-Maurice. (6.11.1998)
Schwerwiegender lastet der dichterische Drang, ein gefühlstrunkenes Stimmungsbild herzustellen, auf dem Werk Rinder, Kinder und Propheten. Problematisch ist, daß der Autor Figuren der Walliser Geschichte wie Supersaxo und Schiner lebhaft und leibhaftig im Text umherpoltern läßt und gleichzeitig aber, als Programm, so chaotisch Zeit- und Ortsebenen durcheinanderschüttelt, daß beim Lesen dieser satirischen Kirchen- und Kulturgeschichte des Wallis der Wunsch nach Informationsgehalten pausenlos in Frustration zerfällt, weil einem ununterbrochen der Boden der Realität unter den Füßen weggezogen wird. Das Buch erzeugt die hitzige, der Intention angemessene Stimmung einer brodelnden und dampfenden Hexenküche, bei der es aber weder klar wird, wo in der Welt sie ihren Platz hat noch was und zu welchem Zweck am Kochen gehalten wird.
Etwas langsamer auskomponiert ist die Textsammlung Die Walliser. Dichtung und Wahrheit, da deren Einzelstücke in sich abgeschlossen und auch bezüglich der Syntax weniger komplex strukturiert sind. Indem durch die einfachere Anlage der Benennung Vorschub geleistet wird, ist es weniger deren Abwesenheit, die kritische Gedanken als bloßes geschmäcklerisches Gefühl verpuffen ließe, als die Register der Klischees, die Chappaz in diesem Buch hemmungslos zieht, ob denen man ungläubig den Kopf schüttelt.
Neben dieses regressive Werk, das nur dank des Humors und einer Fülle von sprachlichen Spritzigkeiten die karge Ästhetik des Adolf Fux übersteigt, insgesamt aber die Grundmotive alter Vorurteile übers Wallis nirgends kritisch aus den Fugen drängt, gesellt sich strahlend der kleinformatige Haupttext, an dem Chappaz am längsten arbeitete, Gesang von der Grande Dixence. Wohl weil dieses Werk lange in Arbeit war, korrespondieren die Bilder derart eng mit den Geschehnissen in der Realität, wie die Arbeit in den Stollen für die monumentale Staumauer und ihre Zuflüsse hat gewesen sein müssen. Je prosaischer der Gegenstand, desto kraftvoller Chappaz‘ poetische Leistung und desto verbindlicher die Kritik, die nicht einfach das Bauen und den Bau ablehnt sondern quasi noch einmal aushöhlt, um die Frage nach ihrer Notwendigkeit als komplexes Gebilde positionieren zu können. Obwohl präziser und triftiger als alle informationsfixierten Reportagen und Bilder zur großen Mauer im Vallée des Dix, droht nie die provinzielle Gefangennahme in eine zentrale Frage, die die Landschaft Wallis allein betreffe, weil die künstlerisch-kritische Arbeit sowohl am sprachlichen Material wie dem ästhetischen Gehalt die Zügel nicht locker läßt. Gerade weil so viel Anstrengung in die künstlerische Durchgestaltung eingelassen worden ist, transzendiert der kritische Gehalt die Enge der Schluchten und schafft Bewußtsein immer schon auch anderswo.
Weniger auf Kritik ausgerichtet ist des Dichters vielleicht bekanntestes Werk im deutschen Sprachraum, Lötschental. Die wilde Würde einer verlorenen Talschaft, wo der Unterwalliser Schriftkünstler die nachgelassenen Fotoarbeiten des Bildkünstlers Nyfeler, der aus der Ausserschweiz stammte, sein ganzes Arbeitsleben aber im Lötschental verbrachte, sozusagen kongenial ausbreitet und mit Texten auspolstert.

Dent d’Hérens mit Plateau am Col d’Hérens, Erholungspassage der Haute Route. (18.7.1998)
Eine Poesie schließlich ohne Zweck wird bewundernswürdig im gletschersoziologisch besonders aufschlußreichen Werk realisiert, der Haute Route. Dadurch, daß das überaus gelungene Werk eine allgemeine theoretische Neugierde zu fesseln versteht, weil es Befindlichkeiten am Rande der Gletscher und auf ihnen zur
Sprache bringt, ist es alles andere denn eine Ergänzung zu Darbelley 1987, welcher Bildband die berühmte Alpentour von Chamonix bis Saas Fee touristisch dokumentiert, so daß sie den Menschen des Bergsports als Notwendigkeit erscheint. Chappaz‘ Dichtung, die sich programmatisch von den Bergreportagen absetzt, benötigt einen Sechstel des Umfangs zur Exposition der Gefühlslage vor
dem Beginnen. Diese Seiten bewegen sich im Raum des Hauptwohnorts des Dichters, im Val de Bagnes, der Region auch des Fotografen Darbelley und des Extremskifahrers Saudan (beide zwischen Martigny und Col de la Forclaz). Recht viel Text wird für die Zeit des Anmarsches investiert. Hier zeigt sich die Schwierigkeit im Zurückhalten gewöhnlicher Benennungen, da es sich nicht 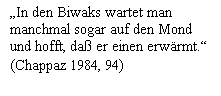 sagen läßt, ob der Wanderer sich am Rande der Reben in Visp bewegt oder quasi vor der eigenen Haustür. Wie der Catogne,
hingewürfelt, den Raum der ersten Zeilen festlegt, den Wohnort Chappaz‘ und auch den Ausstieg aus der Haute Route, orientiert in der Lektüre der zweite genannte Berg nach einem Viertel, der Alphubel, dem die Mischabel sogleich folgt, daß die Tour in Saas Fee begonnen wird. Von hier weg organisiert sich der Text von alleine, da er nur noch auf die Gletscherwelt sich bezieht, die, wie
angetönt, Chappaz nicht als Hochleistungssportler in einem Zug von Saas Fee nach Chamonix durchquert hat, sondern in mehreren Versuchen angegangen ist, um mit des Dichters Respekt von dieser Welt in komplexen, konfigurativ das Soziale stets mit einbeziehenden Stimmungsbildern Zeugnis abzulegen statt über sie durch Aufzählen gewagter Taten pseudoselbstbewußt Fahrtenrapporte
anzufertigen.
sagen läßt, ob der Wanderer sich am Rande der Reben in Visp bewegt oder quasi vor der eigenen Haustür. Wie der Catogne,
hingewürfelt, den Raum der ersten Zeilen festlegt, den Wohnort Chappaz‘ und auch den Ausstieg aus der Haute Route, orientiert in der Lektüre der zweite genannte Berg nach einem Viertel, der Alphubel, dem die Mischabel sogleich folgt, daß die Tour in Saas Fee begonnen wird. Von hier weg organisiert sich der Text von alleine, da er nur noch auf die Gletscherwelt sich bezieht, die, wie
angetönt, Chappaz nicht als Hochleistungssportler in einem Zug von Saas Fee nach Chamonix durchquert hat, sondern in mehreren Versuchen angegangen ist, um mit des Dichters Respekt von dieser Welt in komplexen, konfigurativ das Soziale stets mit einbeziehenden Stimmungsbildern Zeugnis abzulegen statt über sie durch Aufzählen gewagter Taten pseudoselbstbewußt Fahrtenrapporte
anzufertigen.

Eison, Pas de Lona, Sasseneire. (20.7.1997)
Stimmung ist auch die Kategorie, die die Werke Pierre Imhaslys zentral bestimmt; allerdings ist es diejenige eines Jüngeren, diejenige eines Wachsenden, also eine abrupter sich wechselnde als bei Chappaz. In den ersten Werken beziehungsweise dichterischen Arbeiten ist sie ganz ins Idiom der Popkultur eingelassen, was es
ermöglicht, recht frech & frisch Walliser Themen sozusagen vorweltlerisch und aufmuckend-kritisch in großzügiger Sprache in den Raum zu stellen (Sellerie Ketch up & Megatonnen). Was aber in allen Werken ihn fortgeschrittener als Chappaz erscheinen läßt, ist die Überwindung des religiös-kirchlichen Fragehorizonts, der selbst dann, wenn ein Kirchenbau zum Thema wird,
keine Rolle spielt (Hérémence Beton), folglich zur Angelegenheit einzelner mutiert, die ohne weiteres, ohne mutwillige Infragestellung zu akzeptieren ist. Man wird beim Älteren, insbesondere in der Lektüre von Interviews, den schlechten 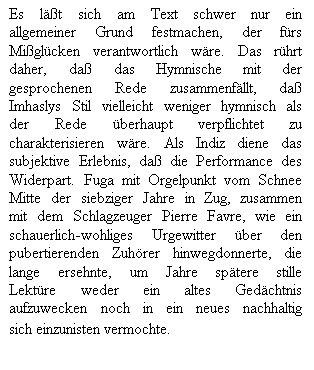 Eindruck nicht recht los, das ideologisch-religiös-klerikale Programm des Gymnasiums von St-Maurice hielt ihn durch Blickkontakt in Bann wie die Schlange die Maus. Obwohl auch Imhasly, lateinerprobt, nicht lebenstüchtig von der Gymnasialzeit sich hat lösen können, welche in Brig kaum weniger kirchenhörig strukturiert
gewesen sein mag als in der Mittelschule am anderen Ende des Kantons, ist er durch nichts an den schwersten der antiaufklärerischen Ankersteine gebunden. Aber aus der Schule plaudert noch die assertorische Denkweise, die als Grundübel ordentlich zu begreifen ist: weil sie sich dem begründenden Zusammenhang verweigert, öffnet sie die Schleusen für die Nichtigkeiten des überlebten
Wissens aus der Sonntagsschule und dem gymnasialen Pfadfindertum. Die einzige Stelle im Gesamtwerk, die Erkenntnis transportiert, findet sich in der Rhone Saga (277), über die Schwierigkeiten, in die die Quartalssäufer gelangen, weil bei ihnen der Alkohol nur sehr langsam abgebaut würde – weil sie auch nach dem Schlafen noch räuschig sind, haben sie überhaupt Lust, weiter
zu saufen. Trotz der starken Entwicklung im künstlerischen Potential ist auch im Stil eine sonderbare Konstante unverkennbar: der hymnotische, hymnotisierende Ton, der nicht wenig an die Cantos Ezra Pounds erinnert und mit dem Ausdruck Sang dieselben ins Blickfeld schiebt – „mein Sang“, das mit Saga wohl mitzuverstehen wäre – beherrscht das ganze Werk, wenn auch am Anfang die
popigen Elemente überwiegen und der Stil in der Frühzeit als Mischung von popiger Hymne, rockigem Gesang und vernünftig-sachlicher Rede erscheint. Ändern wird sich in diesem Komplex nur, daß der Bezugspunkt Rockmusik auf unverzeihliche Weise mit dem des Jazz abgetauscht wird, der weniger als Gattung problematisch erscheint als in der Attitüde, die nur höhnisch gegenüber der
Kunstmusik Stellung bezieht. Das Problematische in diesem Stil, und man kann es nicht genug wiederholen, ist weniger die Hymne, auch wenn sie mal mißglückt und dann natürlich nervt – durch die Strapaze des vornehmen, gehobenen Tons oder das Zuschaufeln sachlicher Gehalte mit metaphorischem, evokativem Schutt – sondern das Ungenügen da, und die Musik wurde eben angesprochen, wo
Kenntnisse Voraussetzung wären. Der knorrige Umgang mit dem Wissen als die Erscheinungsebene des Mangels an Kritik wäre leicht zu therapieren, wenn nur es gelänge, das gewöhnliche kritische Gespräch, die vernünftige Diskussion in den Alltag des Künstlerlebens sich institutionalisieren zu lassen (natürlich durch Lehraufträge). Müßte der Künstler explizit und verbindlich, unter
Umgehung der Spuntenbsöffni, sich zu sozialen und politischen oder anderen gleichwelcher theoretischen Art oder Disziplin kontinuierlich äußern, wäre der Bann leicht zu brechen, der es verhindert, Sachfragen auch in pointiert literarische Gebilde einfließen zu lassen. (Diese Idee ist deswegen nicht trivial, weil man sie bei Chappaz nicht hätte – obwohl sie das uralte Walliser
Provinztum anspricht, hat erst Imhasly das Format beziehungsweise die vorausgesetzte ästhetische Ausrichtung, dieses durch jene diszipliniert abzuschütteln.)
Eindruck nicht recht los, das ideologisch-religiös-klerikale Programm des Gymnasiums von St-Maurice hielt ihn durch Blickkontakt in Bann wie die Schlange die Maus. Obwohl auch Imhasly, lateinerprobt, nicht lebenstüchtig von der Gymnasialzeit sich hat lösen können, welche in Brig kaum weniger kirchenhörig strukturiert
gewesen sein mag als in der Mittelschule am anderen Ende des Kantons, ist er durch nichts an den schwersten der antiaufklärerischen Ankersteine gebunden. Aber aus der Schule plaudert noch die assertorische Denkweise, die als Grundübel ordentlich zu begreifen ist: weil sie sich dem begründenden Zusammenhang verweigert, öffnet sie die Schleusen für die Nichtigkeiten des überlebten
Wissens aus der Sonntagsschule und dem gymnasialen Pfadfindertum. Die einzige Stelle im Gesamtwerk, die Erkenntnis transportiert, findet sich in der Rhone Saga (277), über die Schwierigkeiten, in die die Quartalssäufer gelangen, weil bei ihnen der Alkohol nur sehr langsam abgebaut würde – weil sie auch nach dem Schlafen noch räuschig sind, haben sie überhaupt Lust, weiter
zu saufen. Trotz der starken Entwicklung im künstlerischen Potential ist auch im Stil eine sonderbare Konstante unverkennbar: der hymnotische, hymnotisierende Ton, der nicht wenig an die Cantos Ezra Pounds erinnert und mit dem Ausdruck Sang dieselben ins Blickfeld schiebt – „mein Sang“, das mit Saga wohl mitzuverstehen wäre – beherrscht das ganze Werk, wenn auch am Anfang die
popigen Elemente überwiegen und der Stil in der Frühzeit als Mischung von popiger Hymne, rockigem Gesang und vernünftig-sachlicher Rede erscheint. Ändern wird sich in diesem Komplex nur, daß der Bezugspunkt Rockmusik auf unverzeihliche Weise mit dem des Jazz abgetauscht wird, der weniger als Gattung problematisch erscheint als in der Attitüde, die nur höhnisch gegenüber der
Kunstmusik Stellung bezieht. Das Problematische in diesem Stil, und man kann es nicht genug wiederholen, ist weniger die Hymne, auch wenn sie mal mißglückt und dann natürlich nervt – durch die Strapaze des vornehmen, gehobenen Tons oder das Zuschaufeln sachlicher Gehalte mit metaphorischem, evokativem Schutt – sondern das Ungenügen da, und die Musik wurde eben angesprochen, wo
Kenntnisse Voraussetzung wären. Der knorrige Umgang mit dem Wissen als die Erscheinungsebene des Mangels an Kritik wäre leicht zu therapieren, wenn nur es gelänge, das gewöhnliche kritische Gespräch, die vernünftige Diskussion in den Alltag des Künstlerlebens sich institutionalisieren zu lassen (natürlich durch Lehraufträge). Müßte der Künstler explizit und verbindlich, unter
Umgehung der Spuntenbsöffni, sich zu sozialen und politischen oder anderen gleichwelcher theoretischen Art oder Disziplin kontinuierlich äußern, wäre der Bann leicht zu brechen, der es verhindert, Sachfragen auch in pointiert literarische Gebilde einfließen zu lassen. (Diese Idee ist deswegen nicht trivial, weil man sie bei Chappaz nicht hätte – obwohl sie das uralte Walliser
Provinztum anspricht, hat erst Imhasly das Format beziehungsweise die vorausgesetzte ästhetische Ausrichtung, dieses durch jene diszipliniert abzuschütteln.)
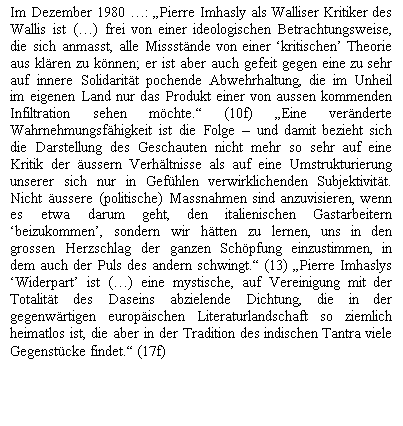
Das Schlechte Imhaslys wurde 1980 besiegelt, in den Preisreden der Gemeinde Visp. Es gelingt dem Autor nicht, sich gegen das aggressive Labeling, das in jenen praktiziert wird, abzusetzen, auf gar keinen Fall ein linker Autor der Schweiz zu sein. Die Hauptrede von Prof. Roland Ris der ETH Zürich hätte als geradezu rufschädigend zurückgewiesen werden müssen. Dessen Konstruktion, die Kritische Theorie sei eine ideologische Betrachtungsweise, die sich anmaßte, alle Mißstände von eben dieser Warte aus erklären zu können, wirft einiges Licht auf Berufungsverfahren an Schweizer Universitäten im Gebiet der Geisteswissenschaften. Daß gegen eine solch schlüpfrige Aufdringlichkeit der Autor sich nirgends wehrt, bricht ihm das Genick; sich gegen die Zuordnung zum Biederen und Falschen nicht zu wehren, beraubt ihn der Fähigkeit zu sprechen, der Fähigkeit, sich souverän zu den Dingen zu verhalten. Von dem Moment an wird es offenbar wichtig, durch Kontrolle der Rhetorik dem sozialen Prestige zu gehorchen statt sich uneingeschränkt zu dem zu verhalten, womit es die Kunst zu tun hat. Die Buchhaltung wäre leicht, alles Störende in den Werken nach 1980 auf Partien in den schlechten Lobreden dieses Jahres zurück zu beziehen.
Es verwundert denn nicht, daß das erste Hauptwerk, dessen Realisierung von solchen Lobreden doch in Schwung gesetzt werden sollte, erst sechzehn Jahre später veröffentlicht wird (sicher, Übersetzungsarbeiten wurden viele vollendet und auf großartige Weise – aber der Staat Wallis soll seine KünstlerInnen nicht zur Dienstfertigkeit anhalten, sondern zur Kunstproduktion antreiben). Die Rhone Saga von 1996 kommt sowohl wegen ihres komplexen Aufbaus wie auch wegen der gelungenen Durchführung detaillierte Aufmerksamkeit zu.
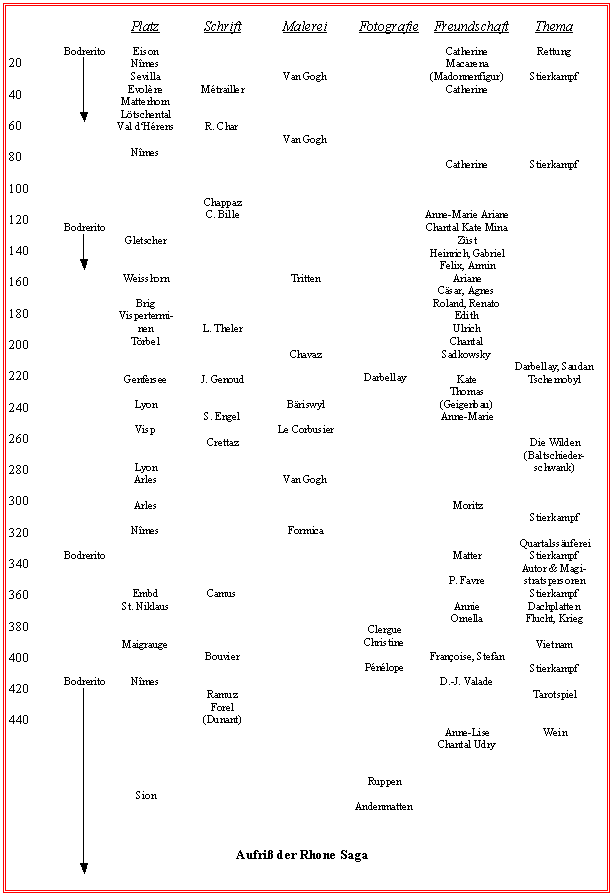
Die folgenden Punkte betreffen die Intention der Konstruktion, also des Dichters Selbstverständnis gegenüber der großen Form, die in sich stimmt, im Beliebigen und Launischen gegenüber der Musik, den Schauplätzen, den Protagonisten und der Kunst gestört wird. Obwohl die Einwände und Statements nur lose zusammenhängen, sollen sie die eine These plausibel machen, daß man das Buch in einem Guß zu lesen hat, klar, mit allen Unwägbarkeiten, weil die große Form eben trägt. Es wäre ein falsches Ideal, das vom Autor nicht wenig verschroben favorisiert wird, das Buch in isolierten Abschnitten zu lesen – weil es in den kleinen Formen unstimmig wirkt. Das dicke Buch lastet auf einer zu schmalen Wort- und Rhetorikpalette, auf einem zu dünnen Wissen, am schlimmsten: auf zu seltenen Durchführungen von angerissenen Stimmungen.

Imhaslys Zuflucht Eison. (20.7.1997)
* Wie steht es mit Imhaslys Verhältnis zur zeitgenössischen Kunstmusik? In auffälliger Weise fehlt der Komponist von Evolène; umgekehrt mangelt es nicht an Invektiven gegen die deutbare Musik, als ob der Autor sich der Regression opfern wollte. Der Komponist Pierre Mariétan (von Monthey) fehlt deswegen, weil die Bilder von Eison, Volovron, Lanna und Viesivi, zu denen er gehört, so gelungen erscheinen. Um so erbarmungsloser marschiert der Jazz: 56ff, 112 (der walliserdeutscheste Satz: „… darum ist der Zwölftonfleiss, am Reissbrett, eine Technik, nicht eine Musik…“), 166, 173, 191, 194, 331 (mit Klassik, mit Brassens), 338f (wieder Georges Brassens, wieder ein Schlag durch Schlager gegen die Musik), 399.
* Wie soll die Zufälligkeit in der Auswahl der Walliser Orte, in der keine Intention sichtbar wird, verstanden werden? Gletsch, Fiesch, Lötschental, Brig, Visp, Baltschieder, Törbel, Eison etc. Diesen Ortschaften an der Rhone, einmal näher an ihr, dann ferner von ihr gelegen, entsprechen die Orte im französischen Teil des Rhonelaufes: Nimes, Arles etc. Die Plazierung der Orte im Buch ist kaleidoskopartig, auch im dynamischen Sinn. Dieser Kunstgriff ist gelungen, weil sowohl die Erwartungen befriedigt werden wie auch immer wieder neu wachsen. Obwohl die einzelnen Orte treffend geschildert werden, wäre man nicht abgeneigt, es käme auch in den Details zu Durchführungen. Außerhalb des Systems dieser Orte gibt es die Erörterungen der spanischen Stierkämpfe, die sich sowohl auf die Spanierin Bodrerito, die Camarguischen Stierkämpfe wie die Ehringer Kühe beziehen. Dadurch wird, äußerst sympathisch, Eison zum Innersten des Buches. Allerdings: obwohl Imhasly viel Inbrunst in Eison legt, fehlt dasselbe gerade da, 298, wo die Herkunftsorte der Mineure der Grande Dixence aufgezählt werden. Einer scheint da falsch auf dem laufenden zu sein, und zwar derjenige, der von der Dent Blanche sagt, sie apere aus, und die Dent d‘Hérens würde nicht ins Val d‘Hérens reichen (33), dabei winken beide in Vex, und in Eison sieht man nur die letztere.
* Sowohl als innerster wie äußerster Bezugspunkt steht Bodrerito. Vielleicht ist es ein künstlerischer Mangel, daß ausgerechnet zu ihr keine Lesebeziehung entstehen will, wiewohl eine solche zu den anderen Frauen sich auf der Ebene von Sympathie oder Neugierde leicht ergibt. Ist das sexy: „… und wie an deiner Schulter / unter Orangenachseln / sonor erblüht / das schönste Küchenlatein“ (412)? Bodrerito ist der Text – Bodrerito und die Gletscher … wirkt sie deswegen so wenig lebendig (nach einem Viertel ist er immer noch in Gletsch, als ob nur Quelle und Mündung der Rhone zu dichten gäben, 113 bis 120)? – Einzelne Frauen sind vereinnehmend dargestellt, sicher Edith, der die Wahl nicht geschenkt wird, das Werk lobenswert zu finden oder nicht. Baeriswyl erscheint als eine Art Gegengewicht zu Bodrerito. Als Fribourger ist die Erwähnung dieser Stadt durch ihn legitimiert; sie wird aber dargestellt wie einer der Orte an der Rhone, was zu einer offenen Dissonanz führt. – Einige Einzelfiguren haben einen kleinen Auftritt, werden aber nur jazzig als ob vorgeführt, mit Initialen und in solch schwacher Färbung, daß kein rechtes Interesse aufkommen mag, weil keine Vermittlung geschieht noch intendiert ist. In der Passage 140 bis 146 ist es unangenehm, nicht durchschauen zu können, ob Personen vorgestellt werden oder Lebensstile beziehungsweise Politisches inszeniert wird. Es handelt sich nicht um eine konstruktive Unentscheidbarkeit, über die man rätseln möchte, sondern um eine stoßende, das Denken blockierende Unverbindlichkeit.
* Die Rhone wird nur zum Anlaß genommen, um durchs Band irrational, mystisch, mythisch drauflosfabulieren zu können. Die Ankersteine sind dann Produkte des gewöhnlichen Bildungshorizontes europäischer Gymnasiasten. Dazu gehört auch der Einsatz von erdrückend vielen Sprachen, der so unmotiviert erscheint, als wie er in einem Atomrausch halluziniert worden wäre (275) – ist es aber zulässig, eine Bieridee breitgewalzt ohne Kontrolle auf eine Leserschaft loszulassen? Eine Formulierung wie „die dämliche kabbalistische Numerologie“ (75) innerhalb eines irrationalen, ideologisch undurchsichtigen Abschnitts zu Chinesischem und Tibetanischem, klingt nicht rätselhaft herausfordernd, sondern im bösen Sinn weltfremd. Man muß hier noch ein bißchen weiterreiten, auf diesem Statement, wo die Chinesen sagen, die Tibeter sagen, die Inder sagen etc., und das Val d‘Hérens der Mère Catherine zum Mandala wird, dann, Seite 78: „Uns ist die Corrida das Zazen, die sitzend zu übende geistige Sammlung.“ Von hier ab ist alles erlaubt, alles gleich ungültig, der Autor braucht nichts mehr zu rechtfertigen. Beispielsweise diese irrationale Passage [es wird eine Tarotkarte gedeutet, Nackte am See, mit Ente(n), mit Sternen; Titel: The Star]: „Ente, Meteorit und ein drittes: das ephemere Leben des ewigen Schmetterlings. Sich verwandeln, stetsfort, auf immer höherer Stufe sich entpuppen, endlich, als menschlicher Stern, leuchtend; Stern, der, was nützen, von uns aus, schwarze Halos, Quasare – Stern, der ein Stück Himmel zur Erde bringt, so dass sich vollzieht die innig ersehnte: die Hierogamie.“ (369) Oder dieser Satz gegen die kritische Vernunft: „Ein Leben lang auf der Reise, nein, ein Nomade mit und in meinem Leib wurde ich, du ahnst es, um zu verinnern, was in dem Wissen der Bücher nicht ist: Welt.“ (353)
* Der schönste Satz? Seite 119: „Dass es hier steht [das Weisshorn], nicht im Tibet, das ist das Wunder!“ Dazu eine passende Passage in die Hosen (125): Das Foto von der Äugstchumme zum Weisshorn ist frühmorgens entstanden, aber Imhasly schwatzt von fünf Uhr abends, „… als im Untergehn die Sonne genau auf dich, Bodrerito, zielte, wurde das Weisshorn: Guernica de Picasso“.
* Das magere Wissen führt zu Sprüchen des Spießertums: a) „si non è vero…“ nicht nur in der Rhone Saga, bereits in den Visp-Variationen von 1976, b) „ich / man müßte dich erfinden“ (21 zu Christina F. de Ginebra und am Schluß der fragwürdigen, aber sehr schönen Passage 148f, die die Sekretärin Edith lebendig werden läßt), c) zu Chappaz: „Crux, Maurice, crimen, Sie waren zu gut“ (86), d) aufgedonnert: „Ehringerkuh vom Stier der Sarazenen“ (90), e) Corrida als Schule des Lebens (95), f) „im Schatten des Peter-Prinzips“ (254).
* Stil und Selbstverständnis: „Eine Art Gesamtkunstwerk. Bei dem die Liebe das Leben wird. Das Leben zum Werk.“ (123) Imhaslys Stil ergibt sich dadurch, daß wohl die Copulation im Zentrum gesehen werden soll, die Copula aber rhetorisch ausgelassen wird. In gutmütiger Stimmung läßt sich mit Bezug auf die Eingangsphrasen formulieren, Imhasly sei nahe bei Arno Schmidt – ohne Satzzeichen – indem die Gedanken spontan gelebte bleiben und auch mal eine thematisch ungeschliffene Wendung riskieren, eine Apostrophe, in welcher die Normen der Schriftsprache nicht als Regelung nachvollzogen werden, die aber weder den Leser noch Bodrerito noch sonst jemanden bös identifizieren soll.
Es ist vielleicht kein Zeichen schlechter Untersuchungsobjekte, wenn das definitive Urteilen sich verläuft und, statt sich durch es selbst von den Texten zu distanzieren, zu ihrer Lektüre auffordert.
Zusatz: Die Malerei
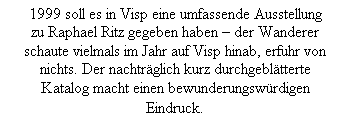 Auch über der Malerei steht als erstes der Satz, daß sie in einer obzwar vom Licht verwöhnten, aber desto ausgedörrteren Landschaft aufgestöbert werden muß – nicht was die Begabungen betrifft, denn diese sind bezüglich der Malkunst in allen Weltgegenden gleichmäßig verteilt, aber bezogen auf die ökonomischen Möglichkeiten, die von der
Umgebung den KünstlerInnen zugemutet werden. Es ist immer dasselbe Schema heranzuziehen: daß einzelne sich durchringen, ihre Talente seriös und professionell auszubilden und, natürlich im Ausland, ausbilden zu lassen. Doch kaum zurück in den Krächen, wird von der sozialen Lebenswelt und den sozial Verantwortlichen alles getan, die Produktion zum Versiegen zu bringen.
Auch über der Malerei steht als erstes der Satz, daß sie in einer obzwar vom Licht verwöhnten, aber desto ausgedörrteren Landschaft aufgestöbert werden muß – nicht was die Begabungen betrifft, denn diese sind bezüglich der Malkunst in allen Weltgegenden gleichmäßig verteilt, aber bezogen auf die ökonomischen Möglichkeiten, die von der
Umgebung den KünstlerInnen zugemutet werden. Es ist immer dasselbe Schema heranzuziehen: daß einzelne sich durchringen, ihre Talente seriös und professionell auszubilden und, natürlich im Ausland, ausbilden zu lassen. Doch kaum zurück in den Krächen, wird von der sozialen Lebenswelt und den sozial Verantwortlichen alles getan, die Produktion zum Versiegen zu bringen.
Gattlen 1961 gibt übers Leben des ersten Walliser Malers Auskunft, Lorenz Justin Ritz, der für sein Lehrwanderjahr im Umfang eines Monatsgeldes Schuhe anfertigen ließ, die darum zur Hölle wurden, weil der Schuster aus der Quantität Leder, die für Ritz bestimmt war, noch ein Handtäschchen, nicht zu klein, für die eigene Frau abzuschneiden beliebte. Ruppen 1971 kritisiert wacker den Sohn Raphael, aber bloß supplementär, am Schluß des Kapitels über einzelne Aspekte; im ganzen huldigt der Text in additiven Setzungen, jede Vermittlung meidend, dem reinen affirmativen Positivismus. Der Hauptvorwurf, von dem man immerhin endlich etwas lernen kann, zielt auf die „… Zerrissenheit des Werkes in ‚Fertiggemälde‘ von starrer Altertümlichkeit und in Studien, welche diesen um ein halbes Jahrhundert vorauseilen“ (94).
Biffiger 1978 und 1984 informieren umfassend über Ludwig Werlen, den experimentierfreudigen, im kalten Kollegium festgefrorenen Maler mit Jugendstilherkunft. Lehner 1982 stellt die Gruppe der Maler in Savièse dar, darunter die berühmteren Edouard Vallet und Bièler; keiner dort war Walliser, so wenig wie der Berner Oberländer Gottfried Tritten, der im benachbarten Grimisuat Wohnsitz hat. Außerhalb der Künstlerdokumentation Oberwallis 1986 und der Künstlerdokumentation Wallis 1992 sind zu nennen Edmond Bille, Schwiegervater von Maurice Chappaz, und Joseph Gautschi, über den Zermatten 1972 schreibt. Allgemein eine große Bildersammlung stellt Jean-Petit-Matile 1985 zusammen. – Eines der berührendsten Walliser Gemälde konnte bis vor kurzer Zeit im Wartesaal des Briger Bahnhofs bestaunt werden, Albert Nyfelers Darstellung eines Holztransportes zwecks Errichtung eines neuen Baues auf einer der Alpen im Lötschental. Da auch im Wallis man vor Vandalenakten sich vorsorglich schützen will, ist das Bild mit unbekannter Destination von der Verwaltung weggeräumt worden.
Will man über die gemachten Nennungen hinausgehen, gelangt man bald in Schwierigkeiten, weil viele Künstler und Künstlerinnen das Wallis als Touristen oder aus sonstigen abenteuerlichen Gründen besucht und daselbst nur eine beschränkte Zeit gearbeitet haben. Gattlen und Aliprandi 1979 stellen die Matterhornmalereien zusammen, dann darf William Turner genannt werden, dem 1998 ein Ausstellung gewidmet war und bei dem zu lernen wäre, daß Stimmung nur aufgrund präziser Artikulation, quasi durch Begriffe geschieht, Gustave Gourbet, dessen Aufenthalt in Martigny nicht besonders angenehm gewesen sein muß, Ferdinand Hodler, Ernst Huber etc.