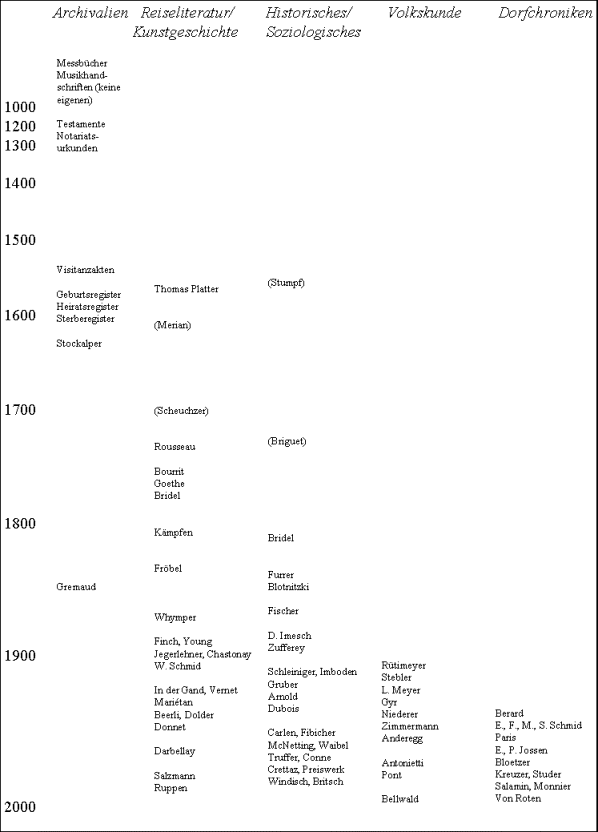Arten des Schreibens
Das Erwachen der Walliser Schrift vollzieht sich in einem Prozeß doppelter Grablegung. Nachdem bereits über ein halbes Jahrtausend die Institution eines als Bischofs-Pfarrer wirkenden Geistlichen zuerst in Martigny (= Octodurus) den Abzug der Römer und die Scharmützel mit den „Völkerwandernden” überlebte (ca. 370 bis ca. 570), später sich in Sitten niederließ (ca. 570), wurde zur Zeit der großen Wende durch Diktat des Burgunderkönigs aus dem Wallis ein auch weltlich-militärisch bestimmtes Fürstbistum, aus dem bescheidenen Bischof ein Fürstbischof, aus dem Bauerndorf Sedunum die kleine Residenzstadt Sitten mit den Verteidigungs- und Verwaltungsanlagen Valère und Tourbillon. War der Bischof auch vorher nicht isolierter Missionar, so wurde seine Umgebung nun präzise strukturiert mit den als Ministerialräten fungierenden Domherren – Geistlichen, die untereinander im Domkapitel eine Familienform pflegten, für sich aber auch mit Frau, Frauen und Kindern lebten – und dem Klerus als dem mal großen, mal kleineren Beamtenstab, Beamtenheer. Aus diesem Klerus erwächst die Walliserschrift, indem jener Begriff beide Tätigkeiten umfaßt: Kirchenmann zu sein und Notar, Kanoniker und Staatsbürokrat, Geistlicher und Buchhalter, Sakristan und Sekretär. Vom großen Klerus werden nun aufbewahrt die Testamente, die Auskunft geben über den Aufbau des Apparats (es sind fast nur Walliser, die begünstigt und angestellt wurden), die Lebensweise (es wurde meistens vom Onkel auf Neffen und Nichten vererbt, das Zölibat also weitgehend eingehalten) und die Vermögenswerte – gänzlich bescheidene.

Sion, hinten links Bietschhorn, rechts Illhorn
Da der Idee des Fürstbistums auch die List vorausgeht, dem Königreich ein Territorium frei der natürlichen Erbfolge und den daraus zwangsläufig entstammenden Erbfolgestreitigkeiten paratzustellen, um der superstrukturellen militärischen Instabilität entgegenzuwirken, ist der zweiten Schriftpraxis des Walliser Klerus ein Paradox beigemischt: Abmachungen, die über die Zeit hinaus Geltung haben sollen, müssen so archiviert werden, daß das Herrschaften, das die Instituierung des Fürstbischofs auf minimster Stufe festhalten soll, sich überhaupt zu einer Form zu fügen vermöchte, sei es zu einer ungerechten, gewalttätigen und militärischen, sei es zu einer demokratischen. Für diese Arbeit, einer der grundlegendsten in der Landschaft, verbreitete sich der Notariatsklerus, dessen Fähigkeit nur darin zu bestehen schien, virtuos und in einer anmutenden Weise lesbar schreibkundig zu sein, in alle Talschaften: auf alle Alpen, in alle Dörfer, zu allen Wasserleiten. Die daraus entstandenen Archivalien, die bis heute an vereinzelten Stellen immer noch nichts Museales aufluden, werden über die riesigen Zeiträume scharf gehütet – so schreibt von Roten 1939 Seite 12 (mit Stern) übers Törbiner Gemeindearchiv, es sei, “aufbewahrt im ‘Gemeindetrog’ d. i. eine starke Holzkiste mit zwei Vorhängeschlössern in der Sakristei der Pfarrkirche; die Schlüssel hat der H. H. Pfarrer” – und auch Ortsansässigen wird launisch zuweilen das Recht auf Einsicht in sie verwehrt (Kuonen 1981).
Das Doppelte der stummen Buchhaltung, abwesend zu sein und dem Leben das Wirkliche zu garantieren, überspitzte ein sehr hoher Kleriker im 13. Jahrhundert: Jakobus, der Schlaumeier aus dem Val d’Anniviers und Vitztum daselbst, also Repräsentant und Vice Dominus des Herren und Bischof von Sitten, verfügt 1284 im Testament, daß seine sterblichen Überreste zur Hälfte als Weichteile in der Kirche von Anniviers (Vissoie), die Gebeine weiters halbiert zu einem Teil in der Abtei Hauterive, zum letzten im Zistensienserinnenkloster Maigrauges in Fribourg zu bestatten seien. Daraus wird ein beileibe nicht geringer Totenzug, um das Glaubensmoment der Unsterblichkeit mit wissenschaftlich-statistischem Kalkül zum voraus garantierte Wirklichkeit werden zu lassen – denn sind die einen Schutzheiligen nicht recht bei der Sache, so ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn denn überhaupt an der Religion etwas dran sein soll, die Erde am anderen Bestattungsort rechtens geweiht (Zenhäusern 1992, 119).
|
Genau hierher gehören auch Stockalpers Handels- und Rechnungsbücher 1987ff, die in über zehn umfangreichen Bänden das notieren, was ihm in der Landschaft geschuldet wird – auch vor dem letzten Acker wird kein Halt gemacht – und von dem er nichts ihr durch Mäzenatentum zurückzuzahlen gewillt gewesen wäre (die zwei, drei gestifteten Kirchenorgeln haben wenig mit Musik zu tun, viel aber mit der Absicherung des eigenen Seelenheils). |
Im Zuge der Gegenreformation, die unter anderem zu vielen Pfarreigründungen führte, insbesondere im Oberwallis – die Gegend um Sitten hatte immer schon ungleich mehr kleinere und mittlere Pfarreien als die Landschaft oberhalb Leuk: um 1500 gab es 12 oberhalb von Siders, 25 im Untertanengebiet und nicht weniger als 30 um Sitten herum bis Siders (Gruber 1932) – wurden zwei neue Arten von Archivtexten institutionalisiert. Einerseits führten die Pfarrhäuser seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts Geburts-, Heirats- und Sterbebücher. Andererseits häuften sich in der Bischofsstadt selbst Schriftstücke an, die wohl zu den interessantesten zu zählen wären, wenn nicht vieles, was generell mit dem Bistumsarchiv im Zusammenhang steht, beim Sittener Großbrand vom 24. Mai 1788 zerstört worden wäre: Der Bischof, der die Pfarreien im größeren oder kleineren Kehr besuchte, ließ sich schriftlich zuvor vom amtierenden Pfarrer eine Akte der Visitanz anfertigen, eine empirische Umfrage, in welcher der Pfarrer seitenweise über sich, die Kirchgängerinnen und das ganze soziale Leben, über das er kraft der Beichte bestens informiert war, Auskunft geben mußte. Ein sehr schönes Exemplar, das einen analytisch erstaunlich offenzügigen Einblick in die gelebten alten Verhältnisse freigibt, präsentiert Studer 1994.
|
Und die Autobiographie des Geißhirten von Grächen zwei Jahrhunderte vor Rousseaus Bekenntnissen? Thomas Platter ist wohl ein Protagonist seiner Zeit, aber eben seiner Zeit im allgemeinen, welcher während einer gewissen Spanne der Reformation auch das Wallis einverleibt war, bis zum Bischof, und in welcher nur wenig gefehlt hätte, dem Wallis eine komplett unverhoffte Wendung zu geben. Platters Vagabundieren bis nach Polen war in ganz Europa für Wissenssuchende gewöhnliche Last, und als er in Zürich beziehungsweise in Basel definitiv festen Boden unter den Füßen fand, blieb das Wallis zwar noch einen Besuch wert, das Schreiben über dasselbe desinteressierte hingegen immer auffälliger. Le Roy Laduries sorgsames Aufdröseln (1998) der Schriften sowohl des Vaters Thomas wie – mehr noch – des Sohnes Felix machen dieselben als Stücke lesbar, als Texte beleuchten sie aber weder das Wallis partiell, das beinahe sich wandelte, noch die europäische Sozialstruktur insgesamt – wo mit dem Humanismus doch mehr ins Spiel geriet als das bloße Abtauschen von Religionsvarianten. Wenn von Le Roy Ladurie sich auch nur knapp das erste Fünftel auf Thomas Platter und das Wallis bezieht, ist die Darstellung doch zu gut geraten, als daß sie sich durch kleinere Studien wie etwa Bumiller 1998 ersetzen ließe. Fürs Wallis selbst war die Autobiographie Thomas Platters nie von Bedeutung, weil sie, geschrieben Mitte des 16. Jahrhunderts, erst Ende des achtzehnten deutsch publiziert wurde, als das Reformierte schon längst ohne Vorbehalte verleugnet wurde. |
|
Da aus dem Innern kein Schriftstück, außer den militärischen und kirchentagespolitischen das Wallis verläßt, und man muß auf diesen wunden Punkt so bös wie möglich den Finger legen, sind Außenstehende dazu aufgerufen, über das Wallis zu schreiben. Der erste macht es ohne Zaudern in einem Best- und Longseller, der einen zweiten – Goethe – dazu bringt, dessen Passage an Ort und Stelle selbst zu wiederholen (Engelhardt 1997, 119 und 127). Jean-Jacques Rousseau wird 1744 mit Schimpf und Schande von seinem Posten als Sekretär des Pariser Botschafters in Venedig vertrieben, von wo er sich mittellos via Bergamo, Como und „Dom d’ossola” über den „St. Plomb” nach Sitten begibt, von da nach Genf und Paris. 1756 schreibt er die ersten Briefe der Neuen Héloïse (fertiggestellt 1758), unter welchen im ersten Teil sich die Nummern 21 und 22 einstimmend, die Nummer 23 ausführlich aufs Wallis beziehen, indem der letztere von der zauberhaften Vielfalt der Landschaft einen Eindruck wiedergeben will, von der Bevölkerung eine Ethnographie, die wunderschöner nicht sein könnte. Hat der Autor sein Objekt der Aufzeichnungen selbst untersucht oder alles nur sentimental ausgemalt, um für die theoretisch-politischen Konzepte, in denen die Walliser nicht mehr eigens erscheinen, ein Muster bereit zu haben? Daß Rousseau im Val d’Anniviers nicht war, wie sieben Texte seit Bourrit 1781 (p. 198ff werden zweidrittel des langen Briefes ohne Herkunftsangabe abgeschrieben) bis zu Chastonay 1939 durch miserables Zitieren einfach so mal in den Raum stellen, hat Liniger 1958 (ebenso 1959) klargestellt. Da der Briefschreiber behauptet, auch auf den höchsten Bergen „in den Wolken einhergegangen” zu sein, hat er vielleicht doch mehr gesehen als den „St. Plomb” und das Rhonetal. Was gilt als wahrscheinlich? Am weitesten, aber in einen Widersinn festgenagelt, will der Herausgeber von Rousseau 1978 gehen, Reinhold Wolff. In den Anmerkungen behauptet er, Rousseau hätte „1744 das Oberwallis, 1754 das Unterwallis bereist” (p. 842, ohne Angaben) – 1744 ist Rousseau aber vom Simplon her durchs ganze Wallis hinuntergereist, also gleichviel durchs Unterwallis wie das Oberwallis, und von einer Reise 1754 ins Wallis hinein liegt nirgends ein Schriftstück vor (die Bootsreise um den Genfersee herum, auf die man zuweilen hinweist, wird auch mit einem Halt in St-Gingolph oder Bouveret nicht als Walliserreise durchgehen können). Behbahani 1989 faßt den redseligen Lathion 1953 und Gagnebin 1966 zusammen und gelangt zum Schluß, Rousseau hätte 1744 für die Durchreise eine Woche Zeit gehabt und so wohl schon einmal bei einer Walliser Familie über das Essen hinaus sich in einen lustigen Weinrausch trinken können, seine Haupteindrücke aber doch wohl hauptsächlich beim nachgewiesenen Gastgeber in Sion aufgelesen, „M. de Chaignon chargé des affaires de France” (Confessions nach Behbahani; hier auch die Schreibweise St. Plomb). Für die schöne Wirkung tut der faktisch abgesicherte Hintergrund nichts zur Sache – und es erscheint ja der Text des 23. Briefes der Neuen Héloïse, der nach der Veröffentlichung des Buches nicht zuletzt wegen seiner stilistischen Raffinesse in einigen Journalen auch separat abgedruckt wird, angesichts des dicken Parfüm- und Gefühlsnebels um ihn herum mitnichten als Lüge.[1]
So sehr die Neue Héloïse, die das Wallis ins bürgerliche Gerede brachte, ein Jahrhunderterfolg wird, den Goethe bereits 1761 deutsch konsumieren konnte – dessen eigene Textfolge, die weit differenzierteres Material übers Wallis offenlegt, war sowohl in der Tagebuchfassung wie in derjenigen der Briefe an Charlotte von Stein zwischen dem 6. und dem 13. November 1779 dem Publikum vorenthalten, und noch heute ist der Zugriff auf sie eher schwierig.[2]
Goethe und Rousseau stehen insofern für den ganzen ersten Schub der Walliser Reiseliteratur, die sich im Jahrhundert nach der französischen Revolution in etwa gleich verhält, als der eine nur in höchsten Tönen von der Bevölkerung und den Verhältnissen (die selbst sich immer auf die engere Lebenswelt, also das Wohnen und Essen beziehen) spricht, der andere wo es am Platze scheint auch massiv distanziert. Es ist kaum abwegig, davon auszugehen, daß in verschiedenen einzelnen Jahren (oder auch über längere Zeitspannen hinweg) an verschiedenen Orten die Wohn- und Arbeitsbevölkerung einmal eher in armseliger, dann in tief beeindruckender, geradezu betörender Atmosphäre anzutreffen war. Was den Applaus auslöste, insbesondere in den Tälern von Hérens und Anniviers, war das Zusammentreffen der allgemeinen Frömmigkeit mit der Schönheit und dem Reichtum der Menschen gleichwie mit ihrer Gastfreundschaft, also dem guten Essen und dem feinen Wein. Es sind recht viele Texte entstanden. Bourrit 1781 erfährt auf jene etwas aufdringliche Weise das ganze Wallis (man hat ihn sich wohl als einen ersten Naturschwärmer aus der Stadt – Genf – vorzustellen, wie Yves Ballu einleitend in Bourrit 1977 ihn darstellt, ein wohlgefälliger Sänger und pedantisch präziser Zeichner, dessen Bilder vom Naturhistoriker Horace de Saussure für die eigenen Publikationen in ihren Perspektiven nachgemessen wurden – aber eben kein Savant mit milde stimmender sozialer Anerkennung). Keine zwanzig Jahre später sind die Gebrüder Bridel 1798 bestürzt über den Weg aus der Derborence nach Aven, loben aber die Verhältnisse von dort via Conthey bis nach Sitten, allerdings nicht ohne sich darüber zu mokieren, daß die Bevölkerung „ihre Butter und ihr eingesalzenes Fleisch nicht eher (angreift), als wenn es Zeit ist, dieselben den Würmern streitig zu machen“ (55). Der deutsche Fröbel 1840 verliert im Val d‘Hérens auf allen Ebenen die Contenance, um im Val d‘Anniviers, von dessen Einwohnern er knapp sieben Exemplare sieht, nur schöne Worte zu finden: „Die Bewohner (des Val d‘Anniviers) sind die einzigen wirklich arbeitsamen Menschen im Wallis“ (137; ev. in einem anonymen Zitat). Obwohl einige Jahrzehnte später entstanden, gehören zu dieser ersten Gruppe der Reiseliteratur auch die Texte von Jegerlehner, der recht anregend wirkt, solange er sich nicht auf schöne Literatur kapriziert, und von einem Pater aus Siders, Paul de Chastonay. Schreibt dieser aus innerer Verbundenheit nur affirmativ, so gelangt dem ersteren ab und zu auch ein Bonmot, wenn er etwa meint, die Anniviarden hätten früher „nach Art der Rüsseltiere“ an Tischen „mit lochähnlichen Vertiefungen“ gegessen (Jegerlehner 1904, 51).
Weniger zur Andacht eines größeren Publikums, das in die schöne Landschaft gelockt werden müßte, als vielmehr sozialtechnologischen und technischen Zwecken dienten die ersten Publikationen im Horizont historischer Aufrisse. Philippe Bridel veröffentlicht 1820 als Pfarrer von Montreux 350 Seiten im Kleinformat 13 x 8 cm über den fünfjährigen Schweizer Kanton Wallis, von denen ein Viertel der Naturgeschichte, einer der Beschreibung der Menschen in den einzelnen Zehnden so, wie es die Reiseliteratur vorführte (in der sich Bridel bekanntlich schon geübt hatte), einer der Geschichte und der letzte den zeitgenössischen Institutionen gewidmet ist; beigefügt ist eine große kolorierte Karte, die einen sehr präzisen Eindruck hinterläßt. Häufiger als der kurzatmige Bridel wird aber Furrer 1850 in Diskussionen beigezogen, da er als Pater vielleicht mehr Gelegenheit hatte, Geschichtliches auch nach verbindlichen Quellen geprüft wiederzugeben. Ihn heute unvoreingenommen zu lesen bedeutet allerdings, freiwillig sich obsoleten Mythen der Walliser Geschichte als mögliches Sprachrohr anzudienen; ein durch minuziöse Kommentare kontrollierter Neudruck wäre dagegen begrüßenswert, gerade weil der Ursprung für viele Unsinnigkeiten, die nicht immer bei Furrer selbst liegen, faßbar werden könnte. Zwanzig Jahre nach Furrers großer Geschichte erscheint das erste Werk, das grundlegend in die Walliser Ökonomie einzugreifen Bereitschaft zeigt, Leopold Blotnitzkis Liste der Suonen und Bisses, zusammen mit den ersten Konzepten zur Rhonekorrektion. Da dieser herausragende Kultur- und Kantonsingenieur des Wallis die Wasserleiten nicht alle selbst abgelaufen war, sondern von den Gemeinden schriftliche Beschreibungen angefordert hatte, die nicht des weiteren überprüft wurden, ist diese Zusammenstellung für uns heute zu lückenhaft und in der Benennung beziehungsweise Beschreibung zuwenig fehlerfrei als daß sie mehr denn nur die gröbste Neugierde zu befriedigen vermöchte [was einem übergeschnappten Lurchen kein Recht gewesen sein wird, dem Exemplar der Berner Stadtbibliothek zwischen April 97 und Herbst 98 mit Leuchtstift und anderen bücherfeindlichen Materialien Wunden zuzufügen]. Immerhin wurde durch diese Schreibarbeit, für welche Kulturingenieure sonst wenig Neigung zeigen, auf massive, bis in die Gegenwart nachwirkende Weise verhindert, daß in den Verwaltungsstädten Sion, Sierre, Visp und Brig, die sich gerade in diesen Jahren von den Sitten und Gebräuchen des Dorfschaftslebens an den Berghängen zu dissoziieren begannen, die Wichtigkeit der Bewässerung nicht nur zur Futter- und Landfruchtgewinnung, sondern auch zum Schutz vor Fels- und Hangabgängen nicht mehr eingesehen würde.
Einen Schatz besonderer Güte vergrub bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fribourgische Priester und Historiker Jean Gremaud (Diesbach 1898), indem er nicht weniger als 3080 Walliser Dokumente in Buchform und mit umfangreichen Registern publizierte – allerdings in der Originalsprache mit einer bloß winzigen Inhaltsangabe auf Französisch. Da kaum mehr als eines nicht lateinisch verschlossen dasteht, sind die Folgen bis heute zwiespältig: wer diese Texte nicht berücksichtigt, läuft Gefahr, unnötigerweise an falschen Phantasien weiterzuspinnen – aber der lateinischen Sprache Huld zu erweisen ist auch bei geplagten GymnasiumsabgängerInnen altsprachlicher Richtung nicht jedesmenschen Sache; nur schon die Ortsnamensuche hat ihre Tücken, einzelne konnten überhaupt nicht bestimmt werden. Immerhin lohnt sich ein Blick in den ersten Band: für die erste Hälfte des ersten Jahrtausends werden knapp drei Druckseiten benötigt, für die zweite Hälfte mit 65 Dokumenten sechsundvierzig. Hier ruht das Material für die Wiedergabe der räuberischen Geschichten mit den Langobarden (Nr. 14, halbe Seite, Jahr 574) und den Sarrazenen (Nr. 61 bis 64, zehn Seiten, Jahre 940 – 972). Nichts aber findet sich darüber, daß die beiden Gruppen hätten Wohnsitz nehmen wollen, nichts über Hannibal und die Elefanten, nichts über Attila und die Hunnen. Die diskursive Geschichte der Walliser Landschaft scheint sich vom ersten Jahrtausend ablösen zu wollen, um sich desto tiefer, immer aber noch lateinisiert grimmig festgemauert, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends einzuschreiben.
Mit der Gründung der Alpenclubs während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz, in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien und England, deren Mitgliedschaft personell sowohl mit einer gewissen Adels- beziehungsweise Großbürgerschicht wie aber auch mit dem Universitätsleben, insbesondere an den naturwissenschaftlichen und medizinischen Abteilungen liiert war, erwuchs eine Reiseliteratur, die sowohl wissenschaftlichen Zielen diente wie aber auch individuelle Bestleistungen zwecks sozialer Anerkennung dokumentierte. Die wissenschaftliche Fragestellung ging nicht weit über das Problem hinaus, ob man die Formen der Berge und Täler der Faltung von Platten, also Kontinenten zuzuschreiben hätte oder ob den Gletschern bei diesem wundersamen Werk ein mehr oder weniger großer Anteil zukomme. Noch bevor sich die Geologie als Fach von der bloßen Idee der Naturgeschichte abgelöst hatte, verschwand der Personalunionismus von Naturforschenden und AlpinistInnen aus der Berglandschaft. Der bigotte Kampf um Anerkennung zeigte sich zunächst als Kampf um die Erstbesteigung der markanten Berge (Whymper 1871), dann um die der schwierigsten Gipfel und Türme (Finch 1924 und Young 1955), dann um die der Grate und Traversen (Biner 1994, umfassender Brandt 1993); in schlimmeren Fällen ging es um die bloße Geschwindigkeit oder ums Sammeln einer bestimmten Menge von Gipfeln in limitierter Zeit. Obwohl der Zweck dieser Literatur nur wenig zur Erkenntnis des Wallis beiträgt, zeichnen die Autoren zuweilen sehr faszinierende Portraits ihrer Bergführer, ohne deren Kraft und Trittsicherheit kein Unternehmen gelingen konnte wie andererseits dieselben den Gast voraussetzten, um das Klettern als Tätigkeit des Broterwerbs möglich zu machen (Antonietti 1994).

Matterhorn
Um die Jahrhundertwende entstehen einige historische Werke, die paradigmatisch einzelne Perspektiven verdichten, zueinander sich aber höchst heterogen verhalten. Steht der Ungare Fischer 1896 für alle spintisierten Phantasien, die fürs ganze Wallis oder einen Teil davon einen besonders wilden Ursprung suchen – die Druiden, die Araber mit und ohne Perser, die Hunnen mit und ohne Attila, die Karthager mit und ohne Hannibal, mit und ohne Elefanten etc. – und steht Dionys Imesch mit den Blättern aus der Walliser Geschichte ab 1890 für die autoritätsgläubige Fixierung der Geschichtsbetrachtung auf die Staats-, Militär- und Kirchendokumente, die von den Priestern, die in Geschichte dilettierten, an große Persönlichkeiten des Wallis geheftet werden, so geschieht beim meist stellenlosen Hungerkünstler Dr. theol. Erasme Zufferey insofern etwas Neues, als er für eine ganze Talschaft die Archivstücke der Dörfer und Pfarreien obsessiv aufdeckt, wie wenn es möglich wäre, das alte Leben trotz der bürgerlichen Revolution und trotz der kapitalistischen Produktionsweise (die nur dadurch schlechten Eindruck machen, weil sie das katholische Dogma erodieren) am Leben zu erhalten, durch konkretes Wiederzusammenfügen notarieller Fakten aus dem bäuerlichen Arbeitsalltag statt wie bei seinen gutsituierten Amtsbrüdern im Oberwallis durchs Präsentieren von Herrschaftsentscheiden.