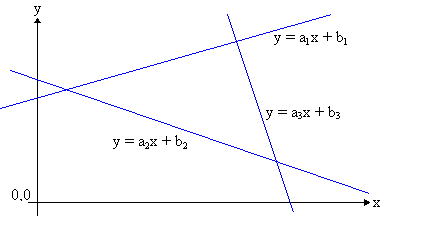
Musik und Geist beim jungen Adorno
Wird im Hinblick auf ein Wissen, das nicht exklusiv Naturphänomene thematisiert, der methodologischen Forderung nach Gegenwartsbezug nachgegeben, die beim jungen Adorno als systematische Wendung gegen den Historismus und die Idee der reinen Geisteswissenschaften schon differenziert war nach
a) dem Stand von begrifflich-theoretischer Erkenntnis und
b) dem strukturell Wesentlichen einer gegebenen Gesellschaft,
so wäre bezüglich b) zum einen zu sagen, dass sowohl die Waffendeponien wie auch die Glaspaläste des Finanzkapitals, die entscheidend das Weltgeschehen prägen, eine herkömmliche politische Einflussnahme strukturell nicht mehr zulassen, zum anderen, dass durch das unaufhaltbare Wirken der erwähnten zwei Momente Waffen- und reiner Kapitalhandel die relative Geschlossenheit der Gesellschaft – wie die europäische und amerikanische der zwanziger Jahre, von denen in einem prägnanten Sinne noch „wesentlich“ hatte gesprochen werden können – heute nicht mehr vorstellbar ist, weil sowohl real wie auch bloß massenmedial alle Weltorte gleiche Priorität erlangt haben; es ist nicht nur moralisch zum Widersinn geworden, einzelne Territorien der Weltgeschichte wichtiger zu nehmen als andere. Weil so viele Waffen produziert worden sind, sei es in ökonomischer oder ideologischer Notwendigkeit, sprechen diese nun da, wo sie gelagert wurden, und mit der Wirkung, die der Unkontrollierbarkeit ihrer technischen Mächtigkeit entspricht. [1]
Ich gehe davon aus, dass die Rede vom methodisch geforderten notwendigen Gegenwartsbezug in einer Erkenntnisproduktion nur möglich war durch einen heute falsch anmutenden Rückgriff auf den Begriff des Geistes: der aktuelle Stand einer thematischen und sachlichen Erkenntnis, die substantiell weder auf Naturphänomene noch auf solche der Ökonomie bzw. der Verwaltung komplexer Gesellschaften ausgerichtet ist, korrespondiert mit der historischen Organisation der Gesellschaft als dem Stand des objektiven Geistes. Im Zentrum des Adornoschen Œuvres ist dieser Begriff zwar der Kritik ausgesetzt wie ähnlich streng nur noch in der Dekonstruktion Derridas; die ihn betreffenden Passagen im Kapitel „Begriff und Kategorien“ der Negativen Dialektik lassen kaum eine Regung seinerseits gelten. Trotzdem bildet er einen vitalen Nervenstrang in der Argumentation Adornos, und er elektrisierte unüberhörbar diejenigen Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die Adorno konstruktiv Wirkung hatte und über die vermittelt er auch auf die jüngere Komponistengeneration teilweise noch heute Wirkung hat.
Neben Stockhausen und Metzger hat Boulez während langer Zeit angekündigt, das allgemein Ästhetische, das strapaziös ein Wissen über den historischen Stand oder Standort von Gesellschaft voraussetzt, mit einer Theorie zu ersetzen, die das Handwerkliche des Komponierens in den Vordergrund rückt, nicht mit der Absicht, das Komponieren durch eine Handwerkslehre zu kodifizieren, sondern mit der Intention, es selbst verbindlich und gleichzeitig die scheinbar verwirrende Begriffskomplexität im ästhetischen Sprechen über Musik obsolet zu machen. Die dilettierende Soziologie in der Musik bzw. im Musikleben, die unnötiger Unschärfe Vorschub leistet, soll dadurch zu einem Ende geführt werden, dass die Musiktheorie die aktuellen Komponierpraktiken in der Weise beschreibt, dass sich eine geschichtsphilosophische Normenorientierung wie bei Adorno nicht mehr weiter aufdrängt; auf diese Weise sollte auch deren Ethnozentrismus wenn schon nicht gelöst, dann doch zumindest kritisch exponiert werden können. [2]
Boulez' Bemühen geht dahin, die Verbindlichkeit der Musik da zu verankern, wo die Musiktheorie sich von der Gesellschaftstheorie entkoppeln lässt. In den Publikationen bis hin zu Jalons scheint ihm das missraten – über seine praktisch-empirische Lehrtätigkeit wird wohlweislich nichts gesagt – und die anderen zwei Genannten haben sich in einem Rahmen, der lose Bemerkungen verbindlich gestalten würde, noch nicht geäußert.
Das bedeutet, dass die „falsche“ Theorie unverarbeitet, jedenfalls unbewältigt immer noch im Recht sitzt. Der vorliegende Text, in dem der junge Adorno im Zentrum steht, soll zeigen, in welcher gespannten Weise sie dies tut – im Bewusstsein, dass ihre Darstellung sich keineswegs der Gefahr der Irrelevanz enthobenen wähnen darf, weil auf eine Lösung hin, die eine Lösung aller Fragen des Ethnozentrismus zur Voraussetzung hätte, eben nicht spekuliert werden kann.
In jener frühen Phase bis Ende der zwanziger Jahre war eine Theoriefassung zu entstehen im Begriff, die dem Geist terminologisch nicht den Tribut hätte zollen müssen, den sie schließlich leistete, wenn Adorno seine Deutungskonzeption nicht so bitter konsequent in einer Gesellschaftstheorie verankert hätte, indem er sie auf den Stand der Gesellschaft – den damaligen Faschismus – projizierte. Das klingt der Intention widersprechend programmatisch nach einem Postulat der Möglichkeit eines Neuansatzes der negativen Dialektik. Solches Unbehagen soll aber mit dem Hinweis abgefangen werden, dass es immer auch möglich ist, beim späten Adorno die widersprüchlichen Einstellungen zum Geistbegriff produktiv einander entgegenzustellen: es gibt auch im Spätwerk Lektüren des frühen, und die erwähnte Passage in der Negativen Dialektik steht als ein Beispiel dafür. Bei einem Lektüreverzicht auf nachstehende Arbeit geht folglich nicht viel verloren, wenn Adorno kritisch verstanden werden soll, einen das Thema „Musik und Geist beim jungen Adorno“ aber nicht interessiert; der späte Adorno enthält ausreichend Materialien zur Selbstkritik, die nur in angemessener Form hervorgehoben zu werden brauchen.
Das Vorgehen ist einfach, wenn auch partienweise im Zitieren aufwendig. In der Einleitung wird das, was den jungen Adorno ausmacht, historisch situiert, mit der methodologischen Intention, es mit dem neuesten Stand von Theorie zu kontrastieren, die wegen des expliziten, nichtsdestoweniger distanzierten Bezugs zu Adorno bei Habermas festgelegt wird. Die Einleitung situiert den Begriff des Gebildes in bezug auf die Geschichte der Theorie (1.1 bis 1.4) und gegenüber dem Stand der Theorie (1.5 bis 1.6.3). Zur Konstruktion der Hypothesen ist der Abschnitt 1.6.4 einigermaßen wichtig, weil er eine Vorstellung von der Struktur dessen vermitteln soll, was der Erfahrungshorizont Adornos effektiv war. Dadurch streifen sich in der Einleitung sowohl theoriegeschichtliche mit erfahrungsrelevanten, also persönlichen Voraussetzungen, wie diese dann auch zusammenkommen mit methodologischen, den falsifizierbaren Hypothesen.
Im zweiten Kapitel wird das, was den jungen Adorno ausmacht und was im Anhang aufgelistet ist, extensiv dargestellt. Die Ausführlichkeit macht die Lektüre nicht gerade zu einem spannenden Erlebnis – sie soll allerdings auch die Möglichkeit bieten, das was in den Gesammelten Schriften zerstreut ist, weil es in der Edition thematisch gruppiert wurde, auch für musikhistorisch nicht Interessierte lesbar zu machen; völlig nebensächlich oder ganz ohne Erkenntnisgewinn ist dies deshalb nicht, weil es sichtbar macht, wie Adorno weniger von seinen Mentoren und Vorbildern Kracauer, Benjamin, Simmel, Nietzsche, Bloch und Lukács, bei denen er sich doch sogar Zitate ohne Vermerk zu entleihen erlaubte, beeinflusst war, als eben an der Musik durch Bescheidung auf eine möglichst immanente Analyse seine antihermeneutische Logik des Zerfalls als Urform der Negativen Dialektik entwickeln konnte. Folglich stehen hier im Zentrum Adornos Konzert- und Werkkritiken der zwanziger Jahre, die dadurch charakterisiert sind, dass sie mit an Kant gemahnender Redlichkeit die Analyse der Musik in Gang bringen, ohne auf eine ideale Theorie vorzugreifen und die Werke ungerechtfertigterweise an einer solchen zu messen. Mitte 1928 erfolgt eine Zäsur, die die Ungewissheit in den bisherigen Analysen zu einem Ende bringt, indem sie sie als die Epoche des Expressionismus erkennt.
Das dritte Kapitel thematisiert Momente des Übergangs des jungen zum reifen Adorno – die dreißiger und vierziger Jahre – wo der Geistbegriff unverhohlen präsent ist, insbesondere in der Philosophie der neuen Musik, die bekanntlich eng zusammen mit der Dialektik der Aufklärung zu lesen ist. Die Konzeption von Musik als der Dialektik von „Konstruktion und Ausdruck“ wird mit der von Boulez vorgeschlagenen (und bei Deleuze entnommenen) von „Découvrir et Reconnaître“, also Entdecken und Wiedererkennen, als Gegensatz diskutiert. – Es gibt zwei Motive in der Entstehungsgeschichte des Geistbegriffes bei Adorno: das eine ist im expressionistischen Vokabular begründet, wie es im zweiten Kapitel ausgebreitet wird; das andere ist im speziellen Rechtfertigungsversuch der Theorie angelegt, wie er die ganze Phase inklusive Abschluss der Dialektik der Aufklärung und der Philosophie der neuen Musik prägt. Die Diskussion mit den theoretischen Entwürfen des Komponisten Boulez soll die Konturen des Geistbegriffs greifbarer machen, wie er in Adornos Gesellschaftstheorie als metaphysische Hypothek deren kritische Fortsetzung zu behindern scheint.
Das abschließende vierte Kapitel versucht dann, die Konsequenzen zu sammeln, die im Detail der Arbeit vielleicht auseinanderzudriften drohen. Die Leitfrage orientiert sich am Begriff der Subjektivität; von dieser behauptet Adorno, dass nur in der europäischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts sie sich voll hätte ausbilden können (12; 134). Obzwar es Adorno gelingt, diese Behauptung an den musikalischen Gebilden plausibel darzulegen, verstellt sie ihren eigenen kritischen Sinn, wenn sie sich von den Entäußerungsweisen außereuropäischer Gesellschaften, die sich durchwegs – ohne Melancholie – in unvollendeter Subjektivität präsentieren, abdichtet. Das Fazit wird darauf hinsteuern, Subjektivität nicht als ein historisches Moment zu begreifen, sondern als eine Kategorie, die ausschließlich gebrochen sich zu formieren imstande ist und deren Ausdruck im 19. Jahrhundert nicht als Ideal, sondern als eine von unendlich vielen Sonderformen zu verstehen ist. Die Gegenwart, auf die sich die begriffliche Deutung subjektiver, sinnhafter Phänomene beziehen soll, wird dadurch dezentriert, insofern mit ihr der Ort des Erkenntnissubjekts gemeint ist; ein passiver Relativismus wird indes immer noch umgehbar sein, als die Begriffe der Deutung diskursiv kritisch gebunden bleiben. Von da her zeigt sich die Kritik an Habermas nicht mehr so trennend, wie sie sich in der Einleitung artikulieren muss, um gesellschaftstheoretisch relevante Momente bei Adorno hervorzuheben, die jener in der Geschichte der Metaphysik ungerechtfertigterweise – und bezüglich seiner eigenen Theorieintention unnötigerweise, aber verführt durch die metaphysische Gier, möglichst „alles“ erklären zu können – versenkt zu sehen trachtet.
1.1 Neuzeit, Bewusstseinsphilosophie (Descartes, Leibniz)
Es ist eine sonderbare Frage, die sich weder durch Textphilologie noch durch soziokulturelle Geschichtsschreibung präzise fassen lässt, dass in der Epoche des Abbruches weg von der dogmatischen Scholastik des Mittelalters hin zur philosophischen Neuzeit die Reflexion darauf, was denn Wissen im Gegensatz zum Glauben sei, eine platonische Form hat wiederannehmen müssen und so den platonischen Diskurs weitergeführt hat, der über 1500 Jahre lang unter dem offen herrschenden Dogma des christlich-klerikalen Glaubens, der verordneten Feindseligkeit gegenüber den intellektualistischen Formen des Wissens oder der Gleichgültigkeit gegenüber dem „Technisch-Wissenschaftlichen“ verstummt schien. Der Platonismus lehrt nichts anderes, als dass die Welt des Vielfältigen nur deshalb erkannt werden könne, weil die vielfältigen Seiendheiten Abbilder von ewigen Ideen sind. Was sich als Frage der Erkenntnistheorie stellt, wird ontologisch beantwortet: die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis der Dinge ergibt sich durch die besondere Seiendheit gewisser Dinge. Die Materialität des Vielfältigen ist flüchtig und daher nicht erkennbar; wenn nicht die vorliegenden Dinge selbst, so sind desto mehr – aber dies ist nicht „mehr“ – die Wesenheiten der Dinge erkennbar. Es gibt also eine Welt hinter der Welt, und es ist gerade das Besondere des erkennenden Menschen, dass er an beiden Welten, oder, um es in der Terminologie eines modernen antiplatonischen Platonismus zu formulieren: dass er an Systemen und deren Umwelten teilnimmt bzw. teilhat. [3] Für den alten Platonismus heißt das, dass der Mensch gleichermaßen zur Welt der materiellen wie der ideellen Dinge gehört. Platons Ideen können hierbei mindestens durch zwei Weisen erkannt werden:
(1) durch mehr oder weniger mystische Anamnese, also durch den Versuch der Erinnerung an den vorgeburtlichen Zustand, wo die Seele des Individuums noch mit den Ideen verknüpft war und
(2) durch pädagogisch-intellektualistisches Sich-Einüben ins Erkennen der Ideen über das Reflektieren und Aneignen mathematisch-geometrischer Modellbeispiele, wobei unterstellt wird, dass die Reinheit der Formen der Geometrie mit den Ideen insofern eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, als die Ideen dem Chaotischen des Vielfältigen zur Form verhelfen. Wichtig ist, dass das, was sich wandelt, was wie Dreck zerfällt oder wie das Böse nur zerstörerisch da ist, nicht erkennbar ist, weil die Ideen von der Welt der materiellen Dinge zwar abgetrennt existieren, in sich aber ein Kontinuum aufweisen, an dessen Spitze die Idee des Guten steht. Nur das ist erkennbar, was sich auf eine Einheit, eine Identität reduzieren lässt. Diese ist nicht das scheinhafte und flüchtige Phänomen, sondern das Wesentliche, Eigentümliche und Eigentliche des Erkenntnisobjekts, oder das Allgemeine spricht platonisch immer auch schon an Stelle des Besonderen.
Ein paar Sätze zur Geschichte: Das antike Griechenland hat sich durch Alexander den Großen so weit ausgedehnt und aufgebläht, dass es dem seinerseits expandierenden Römischen Reich ein leichtes wurde, um 200 v. Chr. Griechenland zur Provinz zu machen. Teil- und zeitweise wurden die Akademien verboten, jedenfalls scheint es ein Wunder zu sein, dass die Platonischen und Aristotelischen Schriften überhaupt in irgendeiner Form erhalten blieben. Wirksam waren sie im Römerreich nicht. Innerhalb dessen konnte sich das an Griechenland orientierte Christentum entfalten, und zwar in der Weise, wie Rom infolge von Finanzierungsschwierigkeiten der Aufrüstung immer mehr zerfällt. Zum militärischen Zerfall Roms kommen zwei oder drei Pestausbrüche sowie die nahezu gänzliche Zerstörung der Landwirtschaft durch Naturkatastrophen hinzu. Hatte das Urchristentum noch eine lebensbejahende Form, so tauscht sich diese nun ab mit einer lebensverneinenden, je mehr sich das klerikale Christentum, das immer stärker mit dem Elend insbesondere der eigenen Gefolgschaft konfrontiert war, etablieren konnte, je stärker sich also die Position des Papstes gegenüber dem Kaiser festigte. Der allmächtige und lobgepriesene Gott des Urchristentums wird zum allwissenden Gott der Theologen. In der Nachfolge Augustins hat sich in Europa eine Kirchenlehre durchgesetzt und um 600 bei Papst Gregor dem Großen konsolidiert, nach der es den Menschen nicht vergönnt sei, mit dem Wissen umzugehen; was einzig im Leben zu zählen habe sei die Demut der Christen und die Gnade des Herrn, und dadurch sozusagen dessen „Pflicht“, durch eben einen Akt der Gnade die Demütigen zu erlösen. Um die Jahrtausendwende werden die Schriften der antiken Philosophen, vor allem aber die des Aristoteles, aus dem alexandrinisch-arabischen Raum in die Klöster Europas importiert. Durch diesen Prozess konsolidiert sich die Scholastik mit der ihr eigentümlichen Aufgabe, die Notwendigkeit des Kirchen- und Bibelglaubens aufzuweisen. Die Philosophie soll also nicht sagen, was Wissen sei, sondern umgekehrt angeben, warum es objektiv notwendig ist zu glauben – nämlich deswegen, weil es kein Wissen zu wissen gäbe. [4]
Bei Descartes artikuliert sich nun der Bruch mit der Scholastik, mit der metaphysisch-ontologischen Begründung des Wissens, die tendenziell mehr einer Begründung des devoten Glaubens gleichkam als einer Darlegung des Vorgangs, wie der Mensch erkenne und wisse. Im Cartesianischen Bruch der Neuzeit mit der Scholastik geschieht auch die Konstruktion eines neuen Weltbildes, dasjenige des Humanismus, in dem die Idee oder die Vorstellung dessen, was der Mensch sei, durch die Tatsache seiner wissenschaftlichen Kreativität gegenüber dem rein platonisch-theologischen Weltbild aufgewertet wird, in dem der Mensch einer fixen Ordnung – eben der Ontologie – gehorchen musste. Denn des Menschen Position war in der Scholastik der Lebensbereich bzw. der ein Leben lang zur Verfügung gestellte Aufenthaltsbereich zwischen dem Reich der Tiere und dem der Engel, nichts, das des weiteren hätte problematisiert werden können. In der Scholastik gibt es über den Menschen nicht viel mehr zu sagen, als dass er in etwa gleich weit entfernt ist vom toten Reich der Materie wie von der ewigen Position Gottes, die sich durch Allwissenheit und Allmächtigkeit auszeichnet.
Ich möchte noch einmal hervorheben, wie unmöglich es ist, diesen Bruch definitiv und eindeutig zu fassen, um in Descartes eigenen Worten zu sprechen: clare et distincte. Was sich sagen lässt ist, dass dieser Bruch vorher nicht möglich gewesen wäre, da es im Mittelalter keine eigentlichen Wissenschaftsdisziplinen hat geben können, weil die Ausbildung von Handwerkstechniken nur mehr oder weniger toleriert, jedenfalls nicht augenfällig gefördert wurde. Bezüglich der Handwerkstechniken kann um 1000 n. Chr. von einer Revolution gesprochen werden, als mit der Erfindung des Räderpflugs sich die Dreifelderwirtschaft etablierte, die gesamteuropäisch den Hunger und die Armut stark zu dämpfen vermochte und dadurch zu einem Bevölkerungswachstum führte. Aber wenn man sagt, dass der Bruch vorher nicht möglich war – und es handelt sich um einen veritablen Bruch und ein historisches Ereignis – dann sagt man noch nicht, dass man die Gründe angeben kann, die den Bruch in dieser Zeit erklären. Und das ist die Frage: sind die Gründe bei Descartes – und in der Folge bei allen Texten, die behaupten, etwas zur Frage beitragen zu können, was Wissen sei – in der Weise evident und einsichtig, dass sie als unabhängiger Ausgangspunkt gelten können, oder zumindest als unabhängiger Kontext, der in sich schlüssig ist, von dem sich alle anderen Formen verbindlichen Wissens ableiten ließen? Das Eigentümliche bei Descartes ist, dass dieser Bruch wohl einem Spalt oder einem Riss gleichkommt – solcher Art wird aber die Abhängigkeit der beiden Seiten nur um so mehr bekräftigt. Wenn dieser angebliche Bruch nur eine Ritze ist, so ist es unmöglich, seinen Akt klar darzustellen, und es ist unmöglich, auf diese Weise zu begründen, weshalb die Geburt der Wissenschaft im 15. und 16. Jahrhundert stattfindet und nicht bereits bei Platon stattgefunden hat. Das bedeutet, dass man nicht sagen kann, ob die Cartesische Philosophie trotz ihres offensichtlich revolutionären und im Angesicht der Scholastik sicher neuartigen Charakters ein Produkt ihrer Zeit sei, das sich sozialhistorisch in seiner Ganzheit begreifen ließe – oder selbst nur ein listiger Effekt des Platonismus und der Metaphysik. [5] Je schärfer es sich nahelegt, in der historischen Abfolge der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorien (im weiten Sinne) von Variationen eines grundlegenden Platonismus zu sprechen, desto mehr Reserve ist auch gegen neuere technisch-technokratische Problemlösungsvorschläge, jedenfalls was weltumfassende Probleme betrifft, aufzubieten und desto mehr ist deren kulturelle, d. h. ethnozentristische Produktionsbedingung in den Vordergrund zu rücken.
Descartes (1596-1650) sagt, dass die Frage nach der Gewissheit von Wissen ihren Ausgangspunkt beim fragenden Subjekt selbst nehmen soll. Die Gewissheit des Wissens liegt im Bewusstsein von sich selbst: im Selbstbewusstsein. Die Brücke aber vom Selbstbewusstsein hin zur Welt des Materiellen, zu der das Cartesische Selbstbewusstsein fraglos noch nicht zählt [6] , ist aus dem Bewusstsein selbst nicht ableitbar: die Res Cogitans, die denkende Substanz und die Res Extensa, die ausgedehnte Substanz sind, was Descartes offen und ohne Bedauern zugibt, nur durch den Glauben verbindbar. [7]
Descartes tut so, als würde er den scholastischen und theologischen Wissenschaftsskeptikern Recht geben, aber er hält dabei die sprachliche Form der skeptischen Äußerungen besonders im Auge. Auf diesem Weg entdeckt er das denkende Ich als körperlose Substanz und als Platzhalter der Gewissheit, als etwas, das nicht in Frage gestellt werden kann, ganz im Gegensatz zum körperlichen Ich und überhaupt zu allem Körperlichen, d. h. zur ausgedehnten Substanz. Das Ich bildet aber nicht nur den selbstgewissen Ausgangspunkt für analytisches Wissen, sondern auch für solches über das mechanisch-technische der Natur, weil durch es die diffuse Mischung zwischen den eindeutigen Bewegungen der Körper in der Natur und den Vorstellungen der Seelen überhaupt zu einem Ende gekommen ist. [8]
Zu Descartes Entdeckungen, die weiterentwickelt werden konnten, gehört die Analytische Geometrie, d. h. die Darstellung geometrischer Sachverhalte in algebraisch-analytischer Form, also in Gleichungen mit bloß zwei Unbekannten – x und y – in denen auch die Grundoperationen der Algebra genutzt werden können. Die Funktionsgleichungen bringen alle ein Abhängigkeitsverhältnis zum Ausdruck, das demjenigen von Grund und Folge bzw. Ursache und Wirkung analog ist. Wenn es für ein Denken nichts Ausgedehntes gibt, das sich nicht mathematisch beschreiben ließe, so gibt es für dieses auch nichts, das nicht einen anzeigbaren Grund hätte.
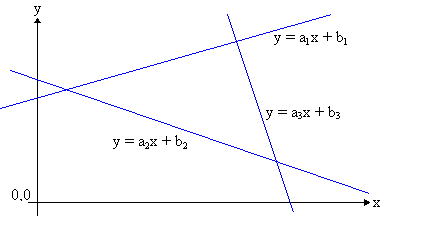
Die drei Geraden, sogenannte Cartesische Normalgeraden, schneiden sich so, dass die geometrische Form eines Dreiecks entsteht. Mit den Gleichungen lassen sich die Eckpunkte bestimmen; mit deren Hilfe dann, zusammen mit den geometrischen Grundsätzen, lässt sich die algebraische Form eines Dreiecks im allgemeinen formulieren, sein Umfang, seine Fläche.
Dieses Bild soll die Einsicht in drei Cartesische Zentralpunkte erleichtern. 1. Die Formel „clare et distincte“ weist auf Kants Formel von dem Verweisungszusammenhang, also der Unabtrennbarkeit von Anschauung und Begriff voraus. Einerseits ist die geometrische Figur das klar Angeschaute, das evident Einsichtige; andererseits ist in der Formel y = ax + b eine gezeichnete Gerade distinkt, d. h. analytisch formuliert. 2. Alles, was der Natur angehört, ist auf solche Weise darstellbar, nicht zu vergessen die Bewegungsabläufe und die Ortsveränderungen von Körpern; selbst komplexe statistische Ereignisse sind in solchen Bildern und Formeln diskutierbar. 3. Je strenger das „clare et distincte“ verstanden wird, um so näher rückt der Cartesianismus zum kritischen Kant: was nicht in eine ähnliche Form gebracht werden kann, bleibt zwar denkbar, ist aber keine Erkenntnis mit ausgewiesener, verbindlicher Gewissheit.
Das Bewusstsein kann alles außerhalb seiner selbst zur Vorstellung machen, d. h. es macht potentiell die ganze Welt zur bloßen Vorstellung. Indem die Vorstellung vom einzelnen Ding abstrahiert, verneint sie seine Wirklichkeit; eine komplexe Vorstellung könnte ein Ding aufs neue konkretisieren, mit der Einschränkung, dass das Wirkliche als Vorstellung bloße Möglichkeit ist. Wenn ich mich umdrehe, kann ich sagen, dass ich bezweifle, dass hinter mir ein Computer zu laut summt und überhaupt ist. Er existiert also nur noch der Möglichkeit nach. Ich kann jetzt sagen, dass ein Computer da ist, dann ist hier ein Computer, aber nur der Möglichkeit nach, denn zur gemachten Aussage gehören auch die illokutionären Formen der Behauptung oder der Annahme. Der Möglichkeit nach steht hier ein Computer, aber auf ganz abstrakte Weise. Jetzt kann dieser Computer sukzessive immer präziser konkretisiert werden, indem immer mehr Attribute aufgezählt werden: die Marke, das Betriebsystem, das Programm, die Chips, die Funktionsweisen der Hardware, die Prinzipen der Quellcodes der Software, die Prinzipien des mathematisch-binären Zeichensystems usw. usf. Gelingt es, diese Konkretisierungen immer weiter zu vervollkommnen – was bei den heutigen Gebrauchsgegenständen allmählich unmöglich wird – und werden diesen Aussagen noch die Platzierung des Computers in Raum und Zeit hinzugefügt, so sind die artikulierten Vorstellungen dieses Objekts nicht mehr nur abstrakt und nicht mehr wahr nur der Möglichkeit nach, sondern es wäre gelungen, diesen Computer begrifflich, das heißt nunmehr eben mit wissenschaftlicher Gewissheit in seiner Totalität zu repräsentieren.
Allerdings macht das Bewusstsein nicht nur die äußere Wirklichkeit zur Vorstellung, sondern auch sich selbst. Die Aussage „ich bin“ lässt sich – als einzige mögliche Aussage – nicht vom wirklichen Aussagesubjekt abtrennen; diese Aussage vermag nicht, das Aussagesubjekt zur bloßen Möglichkeit zu verneinen (wenn man den Computer die Aussage machen lässt, so ist immer auch klar, dass es sich um keine existentielle, sondern um eine gespielte Äußerung handelt). Die Aussage „ich bin ein denkendes Ich“ ist die einzige Aussage, deren Aussagegegenstand nicht angezweifelt werden kann. Die Aussage, hier ist ein Computer, ist offenbar grundsätzlich anders als die Aussage: ich bin da, weil diese letztere immer unumstößlich gewiss ist (die Aussagen „ich bin“ und „ich bin an einem bestimmten Ort“ sind auch im Cartesianismus davon verschiedene, also problematische). „Ich bin denkend“ bildet somit den methodischen Ausgangspunkt für eine systematische Ableitung aller möglichen gewissen Aussagesätze, d. h. für die Wissenschaft überhaupt. Das einsame solipsistische Ich des Cogito ergo sum ist somit der Grund für das methodische Wissen und die verbindliche Wissenschaft. Doch da gibt es eine Schwierigkeit: denn ohne Glauben könnte dieser Grund für die Möglichkeit der Gewissheit keine Allgemeinheit beanspruchen. Das hat zur Folge, dass der Verkehr zwischen den menschlichen Subjekten (die computerisierten könnte man hier mit einschließen), die als bewusste Subjekte nicht zur abstrakten Möglichkeit reduziert werden können, auf dem unsicheren Boden des Glaubens geschehen muss. Es gibt also bei Descartes zwei metaphysische Elemente: den Glauben, dem die Menschen sich zu fügen haben, und das Ich, das nur als vereinsamtes, verbanntes gewiss ist. Descartes kann zwar die Möglichkeit der Erkenntnis von Objekten erklären; sie kann aber nicht lebendige bleiben, da die zur Kommunikation der Erkenntnis vorausgesetzte Intersubjektivität auch nicht in Ansätzen zur Erklärung bzw. Beschreibung gelangt. Alle einzelnen Ichs können den Gewissheit garantierenden Satz aussprechen: Ich bin denkend und folglich existierend; aber die logisch nächsthöhere Aussage: Wir sind, führt in abgrundtiefe Unsicherheit, in ein bekanntermaßen die Polizei erheischendes Chaos.
Leibniz (1646-1716), wohl einer der innovativsten Denker der europäischen Geschichte, wagt die Behauptung, dass es überflüssig sei, den Glauben zu bemühen; es sei sozialpolitisch und ethisch-moralisch betrachtet zwar gut zu glauben [9] , zur Begründung dessen, was das Wissen verbindlich macht, müsse der Glaube aber nicht bemüht werden. Man könne die Möglichkeit sehr wohl im Wissen begründen, dass das Wissen ein Phänomen ist, in welchem die Welt des Denkens und die Welt des Materiellen miteinander verknüpft sind. Der Schluss seiner Darlegungen ist, dass man dasjenige wissen kann, das die Einheit gewährt zwischen dem Ideellen und dem Materiellen. Was bei Descartes im Glauben ruhen musste und dadurch die Vorstellung dessen, was Wissen sei, etwas trübte – das leitet Leibniz frohgemut auf begrifflich-rationale Weise her, mit der logisch unvermeidlichen Konsequenz, dass die Welt im ganzen die beste sein muss, die denkbar ist. Der uneingeschränkte Rationalismus hat in seinem Gefolge auch einen uneingeschränkten Optimismus.
Leibniz sagt, dass es der Fehler der Cartesischen Philosophie gewesen sei, nur von der Mechanik zu sprechen: man müsse dem Begriff des Mechanischen noch den Begriff der Kraft hinzufügen. Der Begriff der Kraft sei das wahre Bindeglied zwischen dem Bereich der frei denkenden Substanz und dem Bereich der mechanisch ausgedehnten Substanz. Wenn die Kraft in Rücksicht genommen würde, könne man davon ausgehen, dass die Welt zusammengesetzt sei aus der Totalität unendlich vieler kleiner Substanzen, die alle die Fähigkeit enthielten – also eine Kraft – sich diese ganze Totalität vorzustellen, sie zu repräsentieren. Er nennt diese kleinen Punkte wahrhafte Einheiten, reelle Einheiten, reelle und sozusagen beseelte Punkte, substantielle Formen, erste Entelechien, ursprüngliche Kräfte und ab 1695 Monaden – und er hat damit nichts anderes entdeckt als die organischen Zellen, welche Entdeckung aber in der Fachphilosophie nach Leibniz wieder verlorenging. Er sagt, sie seien von außen nicht beeinflussbar, weil sie selbst schon das Ganze in sich enthalten würden; die Monaden sind fensterlos. Auch wenn alle Monaden die Totalität repräsentieren, so sind sie doch alle voneinander verschieden, und zwar dadurch, dass jede Monade die Totalität nur mehr oder weniger deutlich repräsentiert, auf nur mehr oder weniger clare und distincte Weise. Es gibt somit winzige Monaden als bloße Zellen, komplexe Monadenverbände wie die Tiere (von denen es keine Individuen gibt, weshalb man nicht vom Tod eines Einzeltieres sprechen könne [10] ), oder solche wie die Menschen, die als Ganzes nun Individuen sind, weil ihnen neben der Welt- und Objektvorstellung (Perzeption) auch eine Selbstvorstellung (Apperzeption) zu eigen ist.
Aber die Monaden haben nicht nur ein kontemplatives Vorstellungsvermögen, sondern auch eine Kraft zur Handlung, eine Kraft zum Eingreifen. Das ist es, was Descartes gefehlt hat und was ihn zum Glauben nötigte. Die Frage ist, ob sich Leibniz, wie er anfänglich behauptet, mit Hilfe des Kraftbegriffs von dem metaphysischen (also nicht klerikalen) Zwang zum Glauben lösen kann. Er sagt, dass ein Chaos zu herrschen beginne, wenn die Monaden nicht durch eine besondere Monade behütet würden. Auf fadenscheinige, nachstehend kurz anzuleuchtende Weise, die deutlich macht, wie Selbstkritik durchaus möglich gewesen wäre und der Akt des dogmatischen Rationalismus keine historische, epochale Notwendigkeit war, postuliert Leibniz eine Urmonade, in der alle Monaden ihren Ursprung hätten, und welche die fensterlosen, d. h. kommunikationslosen Monaden in einer prästabilierten Harmonie verkehren ließe. Das kommt einem religiösen Determinismus gleich, der nicht hätte befolgt werden müssen. Denn das Problem war nur, das mögliche Funktionieren zu erklären zwischen dem Bereich des freien Willens und demjenigen der determinierten Kausalität, keineswegs die Tatsächlichkeit einzelner Ereignisse. Die Aufgabe als Kritik an Descartes war zu zeigen, wie es kommt, dass ein Mensch eine Axt in die Hand nehmen und damit so umgehen kann, dass ein bereitgestelltes Brikett Holz in zwei Teile zerbricht: durch die Kombination nämlich des freien subjektiven Willens und einer Reihe von Kausalprozessen, die nur als einzelne in sich selbst notwendig sind (diese fragliche Kombination hatte Descartes nicht durchschaut); das System von Leibniz suggeriert aber, mit ihm könne vorausgesagt werden, wann und wo eine bezeichnete Person wieviel Holz spalten würde. Darin wird deutlich, wie es die metaphysische Gier ist – der Entscheid in der Antike, das Wesentliche als erkenntniswürdiger einzuschätzen als das tatsächlich Seiende – die dazu verführt, immer mehr erklären zu wollen als von der Sache her nötig wäre, wodurch die Sache selbst einem falschen Schein zum Opfer fällt. Das Katastrophale am metaphysisch-bewusstseinsphilosophischen Erklären ist somit darin zu sehen, dass solche Metaphysik als artikuliertes System nicht ohne Rückwirkungen auf die Ordnung der Dinge produzierbar ist, die auch ohne solche Systematik schon in ausreichendem Maße erklärt gewesen wäre. [11] Die Auswirkungen lassen sich auch leicht vergegenwärtigen, wenn die Zusammenhänge zwischen einem Optimismus, der sich weltanschaulich neutral gibt, und der darin scheinbar vorbehaltlos praktizierten Politik vergegenwärtigt wird.
1695 entledigt sich Leibniz des gestellten Problems also auf nahezu lapidare Art: Dass es in der Welt der Monaden weder – durch telekinetische Störungen – zu einem Chaos kommt, noch die Menschenseelen wie bei Descartes in einem elenden Solipsismus auf sich selbst geworfen sind, spricht für die Unerschütterbarkeit der Hypothese, dass die Monaden, die als nach guten Zwecken strebende Seelen nicht dem Gesetz der Kausalität unterworfen sind, eine um so gemeinsamere Ursache haben:
“Es liegt darin auch ein neuer Beweis für die Existenz Gottes, der von überraschender Klarheit ist; denn die vollkommene Übereinstimmung so vieler Substanzen, die nicht in Verbindung untereinander stehen (weil sie fensterlos und deswegen jenseits des Bereichs der Kausalität existieren; U. R.), kann nur aus der gemeinsamen Ursache stammen.“ [12]
Pierre Bayle wird – und hat es zu dieser Zeit schon getan – über die Vorstellung der Allmacht dieser Urmonade witzeln, die die Bewegungen aller Monaden zu regulieren und zugleich auf deren relative Unabhängigkeit vom Gesetz der Kausalität zu achten hat. Erinnert man sich aber daran, dass Leibniz nichts mit dem materialistischen Atomismus zu tun hat, weil die Monaden keine toten Punkte sind, sondern triebhafte Vorstellungsautomaten [13] , die jeder für sich das ganze Universum enthalten, auf verschiedene Art und mit verschiedener Klarheit – so dürfte einsichtig werden, dass dieser Leibnizische Determinismus eine recht eigentümliche Freiheit garantiert. Denn was dieser Gott reguliert und in prästabilierter Harmonie zusammenhält, sind, zumindest der theoretischen Versicherung nach, nicht einfach so die Ereignisse im Leben, sondern die strukturierenden Gesetze, auf denen sich die Ereignisse bewegen. Dies ist zum einen der Gesetzesbereich der Kausalität, zum anderen der der Zweckhaftigkeit (Christian Wolff nennt dies später die Teleologie), wobei dieser Begriff in seiner ganzen komplexen und dunkeln Mehrdeutigkeit zu verstehen ist: moralisch, handlungstheoretisch, physikalisch, ästhetisch und metaphysisch. [14] 1714 schreibt Leibniz zwei Fassungen des Systems. Die eine wird 1720 als Monadologie veröffentlicht, die andere schreibt er für den Prinzen Eugen, mit dem Titel Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Daraus ein Zitat:
“Da nun infolge der Erfüllung der Welt alles miteinander in Verknüpfung steht [15] , und jeder Körper, je nach der Entfernung, mehr oder weniger auf jeden anderen einwirkt, so folgt daraus, dass jede Monade ein lebender, der inneren Tätigkeit fähiger Spiegel ist, der das Universum aus seinem Gesichtspunkte darstellt und der ebenso geregelt ist, wie dieses selbst. Die Perzeptionen in der Monade entstehen aus einander nach den Gesetzen des Strebens oder nach den Zweckursachen des Guten und Bösen, die in geregelten oder ungeregelten bemerkbaren Perzeptionen bestehen, wie die Veränderungen der Körper und die äußeren Erscheinungen gemäß den Gesetzen der wirkenden Ursachen, d. h. der Bewegungen aus einander hervorgehen. Auf diese Weise besteht eine vollkommene Harmonie zwischen den Perzeptionen der Monade und den Bewegungen der Körper, die vom Anfange der Welt an zwischen dem System der Zweckursachen und dem der wirkenden Ursachen prästabiliert ist. Hierin eben besteht die Übereinstimmung und die natürliche Vereinigung von Seele und Körper, ohne dass eins die Gesetze des andren ändern könnte.“ [16]
Ich versuche, das Terrain ein wenig zu verschieben. Was bis jetzt die Darstellung prägte, könnte man unter den Hut des eindeutig vitalistischen Leibniz stellen, selbst auch die „gemeinsame Ursache“ der Monaden. Die profane Zerrissenheit in der Cartesischen Selbstgewissheit heilt Leibniz durch die Kräfte des Lebens, wodurch er dieses, das Leben, ins Recht setzt, wie vor ihm in der Geschichte der Philosophie kaum je ein Theoretiker es zu tun wagte und nach ihm keiner so insistierend wie Nietzsche – mit Ausnahme des erwähnten Bayle, der dies paradoxerweise als unnachgiebigster Kritiker von Leibniz tut.
Wie sonst nirgends in einer Philosophie ist im Leibnizischen Denken das uralte Theologoumenon von der Gleichzeitigkeit des Voluntarismus bzw. Vitalismus und des Intellektualismus – Gott ist sowohl allmächtig wie allwissend – in folgeträchtigem Maße Voraussetzung. Der vitalistische Leibniz, der Entdecker der Monaden, muss also durch den intellektualistischen bzw. panlogistischen ergänzt gesehen werden. Die mehrschichtig ontologische Fragestellung, die auch dem tätigen Willen Raum lässt, zieht sich zur rein logischen zusammen, die in der Weise nach den Vorstellungen fragt, dass sie sich mit der Kennzeichnung einer idealen, die alle anderen umfasst, begnügt. Diese ergibt sich von einem optimalen Gesichtspunkt her, der in seiner allgemeinsten Form als „die Wahrheit“ einhertritt, so wie sie die Möglichkeit des Verstandes einerseits und die Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung andererseits, einander ergänzend, nahelegen. Welches ist die Form dieser Möglichkeiten der Wahrheit? So wie die analytischen Wahrheiten des Verstandes auf letzte Identitäten zurückführbar sein müssen, so müssen die Sätze übers Empirische begründbar sein. Die unerschütterlichen Prinzipen desjenigen, der sich der Wahrheit selbstgewiss genähert hat, sind der Satz des verbotenen Widerspruchs und der Satz des zureichenden Grundes. [17] Die Auseinandersetzung mit Bayle, auf die hier nur hingewiesen wird, zeigt, plastisch insbesondere in der Theodizee, welche Starrheit sich aus dem Umgang mit diesen Sätzen ergibt, eine Starrheit, die sich nicht mit der Geduld des Ewigen zufriedengibt, sondern Kräfte entfaltet, die die Ereignisse selbst, die dem Wechsel der Zeit angehören, strukturieren, von denen sie, die allgemeinen Sätze, doch sagen, dass sie sie nur betrachten, um von ihnen der Möglichkeit nach Kunde zu geben. Die Fixierung auf die Analyse des logisch Notwendigen ist immer nur zum Schein kontemplativ und immer nur zum Schein rein technisch-instrumentell, denn im selben Zug erklärt sie auch das empirisch Notwendige. Der Größenwahnsinn, ja der Wahnsinn überhaupt des Erklärens bildet immer auch die Grundlage für die allgemeinste, d. h. nicht antastbare, nicht auf das sprechende Subjekt beziehbare, scheinbar nicht ideologische Rechtfertigung der Existenz des Seienden. Dazu eine erhellende Passage aus den Vernunftprinzipien:
“Bis hierher haben wir nur als einfache Physiker geredet: nun ist es Zeit, sich zur Metaphysik zu erheben, indem wir uns des gewaltigen, wenngleich gemeinhin wenig angewandten Prinzips bedienen, wonach nichts ohne zureichenden Grund geschieht, d. h. nichts sich ereignet, ohne dass es dem, der die Dinge hinlänglich kennte, möglich wäre, einen Grund anzugeben, der genügte, um zu bestimmen, warum es so ist und nicht anders. Ist dieses Prinzip einmal angenommen, so wird die erste Frage, die man mit Recht stellen darf, die sein: Warum es eher Etwas als Nichts gibt. Denn das Nichts ist doch einfacher und leichter als das Etwas. Nimmt man weiterhin an, dass Dinge existieren mussten, so muss man Rechenschaft davon ablegen können, warum sie so und nicht anders existieren müssen.“ [18]
Der letzte Halbsatz, der hier hervorgehoben wird, ist derjenige Grundsatz, der die ganze Leibnizische Theodizee reguliert. Man muss sich vorzustellen versuchen, was er bedeutet, wenn er psychologisch aufs eigene Leben, und was, wenn er, etwa in der Form der wissenschaftlichen Soziologie, also verwaltungstechnisch, auf gesellschaftliche, nicht-individuelle Charakteren bezogen wird. An dieser Stelle benutzt ihn Leibniz nicht zur Verklärung, sondern als Bestandteil seines Modells der Erklärung. Denn im Anschluss heißt es:
“Nun lässt sich dieser zureichende Grund für die Existenz des Universums nicht in der Reihe der zufälligen Dinge, d. h. der Körper und ihrer Vorstellungen in den Seelen finden. Denn die Materie ist an sich gegen die Ruhe oder die Bewegung und gegen eine so oder so beschaffene Bewegung indifferent; man kann also in ihr nicht den Grund für die Bewegung überhaupt, und noch weniger (!) für eine bestimmte Bewegung finden.“
Das ist bloße Rhetorik, und zwar eine solche, die das Augenmerk von bestimmten Punkten ablenken soll, insbesondere vom radikalen Wechsel des Argumentationszusammenhangs vom Materialismus zu extramundanen Instanzen, der mit dem Postulat der zwei Gesetzesbereiche zur Erklärung, dass es Bewegung gibt, nicht nötig gewesen wäre. Denn was heißt „man kann nicht“ und „man kann noch weniger“? Ein bisschen also hat die Bewegung mit der Materie zu tun – aber das Bisschen erscheint dem Grundlagenforscher als eher störendes, jedenfalls vernachlässigbares Detail? Die einzelne Bewegung kann auch im extramundanen, nichtmaterialistischen Bereich nur verklärt werden, nicht, wie Leibniz rhetorisch suggeriert, erklärt. Immerhin begrüßte er doch das Werk des Zeitgenossen John Toland, den er auch persönlich kannte (beide waren sie Staatsunterhändler), und er gibt ihm gegen Spinoza Recht. [19] In seinen Briefe(n) an Serena legte Toland – materialistisch – dar, dass die Bewegung notwendig zur Definition der Materie gehöre. [20] Aber der Fortgang der Geschichte beruht ganz offenbar auf Täuschungsmanövern, und Leibniz bewegt sich unbeirrt auf sein Ziel zu, das er sich selbst gesteckt hat, nämlich darzutun, dass das, was sich als Bewegung ereignet, von großer Hand gesteuert wird [21] , seinen Grund also nicht in der Struktur der Bewegung selbst hat.
“Der zureichende Grund, der keines andren Grundes bedarf, muss also außerhalb dieser Reihe der zufälligen Dinge liegen und sich in einer Substanz vorfinden, die die Ursache der Reihe und ein notwendiges Wesen ist, das den Grund seiner Existenz in sich selbst trägt; denn sonst hätte man noch immer keinen zureichenden Grund, bei dem man stehen bleiben könnte. Diesen letzten Grund der Dinge aber nennen wir Gott. (…) Aus der höchsten Vollkommenheit Gottes folgt, dass er bei der Hervorbringung des Universums den bestmöglichen Plan gewählt hat, gemäß dem sich die größte Mannigfaltigkeit mit der größten Ordnung vereinigt: bei dem der Platz, der Ort und die Zeit in der besten Weise verwendet sind, und die größte Wirkung auf die einfachste Weise hervorgebracht wird: kurz, bei dem den Geschöpfen die größte Macht, die größte Erkenntnis, das größte Glück und die größte Güte gegeben ist, die das Universum in sich aufnehmen konnte.“ [22]
Mit diesem letzten Satz, aber auch mit der ganzen Theodizee, die ja darin besteht, den Plan der Welt einer Transzendenz zuzuweisen [23] , macht der intellektualistische Leibniz gegenüber dem vitalistischen einen zünftigen Rückwärtssalto: Die Entdeckung der Gesetze, die die Menschen als solche gleichwertig erscheinen ließen, wird zu Gunsten der Legitimation durch die Geburt aufgeweicht, in der das größtmögliche Glück immer schon seine Anlage gehabt hat. Der Plan ist so, dass von ihm gesagt werden muss, dass er den Geschöpfen, die selbst nicht Bestandteil des Universums sind, das Beste zukommen lässt, das das Universum in sich aufnehmen konnte. Das hat nicht zuletzt auch politische Konsequenzen:
“Il faut reconnoistre cependant que la question combien il est permis aux inferieurs de faire contre les superieurs est extremement delicate et difficile.“ [24]
Der Eindeutigkeit der Form der theoretischen Vernunft, die vom Möglichen der empirischen Ereignisse nur spricht, um sie desto unabänderlicher einer allgemeinen Notwendigkeit unterzuordnen, entspricht die Geschlossenheit der Geschichte, die sich seit je schon in dem Verlangen der Präsentation, des aufdringlichen Vorzeigens ihrer Präsenz gezeigt hat. Die Form der Vernunft der Metaphysik und der Bewusstseinsphilosophie zeigt sich als ein Schema, das sämtliche Abläufe strukturiert und das darin besteht, eine Identität zu unterstellen, von der die Ereignisse, das historisch im Leiden Sedimentierte oder das philosophisch begrifflich Formulierte, ausgeschickt sind. Der Verweis auf diese letzte Instanz, die man sowohl Geschichtlichkeit nennen wie auch als logische Evidenz fassen könnte – dieser referentielle Verweis verschafft dem verständigen Theoretiker, dem vornehmen Philosophen eine Position, die das absolute und untadelige Privileg fürs Argumentieren hütet. Eine solche Position kann nichts erschüttern, da sie sich immer der Struktur, die die Ereignisse formiert, entzieht. Die Berufung auf die Philosophie, als typische Geste sowohl des Berufsphilosophen wie des Ideologen und Dogmatikers, entzieht sich den real-historischen Diskursformationen, die das Feld der sozialen Kämpfe sowohl abbilden wie konstituieren – sie entzieht sich also den Bedingungen der Möglichkeit der Problematisierung der Negativität einer bestimmten Gesellschaft. [25]
Wie aber könnte eine Kritik an diesem Schema obsiegen, wenn dieses selbst doch die privilegierte Stelle der Argumentation einnimmt, wenn also von ihm gesagt werden muss, dass es das Kritische und Subversive in sich einschließt nicht weit entfernt davon wie das Cartesische Cogito das Wahnsinnige, das Unvernünftige einschließt und es so zum Schweigen bringt, unduldsam, unter disziplinarischer Wache? [26]
Die Geschichte schaut nicht im geringsten danach aus, als hätte das Schema nicht auch die heftigsten Angriffe zur eigenen Stärkung sich einzuverleiben vermocht. Denn eine Geschichtsschreibung, die die jeweiligen zeitgenössischen metaphysikkritischen Positionen zu ihrem zentralen Erkenntnisgegenstand machen würde, hat sich bis heute noch nicht im institutionalisierten Wissenschaftsbereich wahrnehmbar und sinnvoll als rationale und gehaltvolle Forschungstradition etablieren können, auf die es sich argumentativ beziehen ließe.
1.2 Idealismus, Metaphysik (Kant, Hegel)
Kant (1724-1804) setzt dem Leibnizischen absoluten und dogmatischen Rationalismus ein scheinbar bescheideneres Konzept des Wissens entgegen, das auch dem Skeptizismus Humes, der nicht frei von einem defätistischen Einschlag ist, Rechnung tragen soll, also der positivistischen Ansicht, dass reine Vernunfterkenntnisse wie die alten scholastischen Realdefinitionen oder Leibnizens Postulat der Urmonade bloße Verführungen der Begriffe seien; realistisches Wissen wäre dem entgegengesetzt abhängig von der sinnlichen Erfahrung, und aus diesem Grunde sei es auch nicht auf alle Zeiten hin gewiss.
(Vielleicht ist dies der grundlegende Fragebereich der Philosophie im emphatischen, aber nicht-metaphysischen Sinn, situiert zwischen die vier Pole
1. der evidenten Empfindung eines äußeren Ereignisses vs.
2. der ökonomischen Verzehrung des letzteren im Gedächtnis bis hin zum Vergessen,
3. der schwachen Ahnung bzw. dem bloßen Phantasieren und der Lüge, der falschen Aussage vs.
4. der argumentierenden Behauptung und des bewiesenen Urteils.)
Ist es aber zeitlich nur bedingt gewiss, so steht die Frage nach der Gewissheit von Wissen überhaupt auf dem Spiel. Man muss fast sagen, Hume sei der Meinung, dass das, was man gemeinhin Wissen nennt, auf bloßer Konvention gründe. Berühmt ist seine psychologische Deutung der Kausalität: Es gibt nicht eigentlich eine determinierende Kausalität in der Wirklichkeit, sondern es gewöhnen die Menschen sich an bestimmte Abläufe, in denen sie damit rechnen können, dass ihre Erwartung in Erfüllung geht, dass nämlich nach einem Ereignis A auch das Ereignis B stattfindet. Diese Befriedigung in der Erwartungshaltung wird in der Erfahrung psychologisch extrapoliert und in die Wirklichkeit projiziert, so dass die Meinung aufkommen muss, es gebe in der Natur so etwas wie Kausalität durch Notwendigkeit, Kausalität als Prinzip, kausale, d. h. nichtlogische Notwendigkeit. [27]
Kants Konzeption erscheint auf die ersten Blicke hin einleuchtend, brauchbar, plausibel, evident und wahr, auch heute noch (keine Affinität zum Kantianismus zu haben ist mindestens so schwierig wie als folgsamen Kantianer sich erklären zu wollen). Sie besagt, dass man zum Wissen ein Verhältnis haben soll wie zum sogenannten Menschenverstand im Alltag: erklärbar sind nur die Dinge, die der Logik des Verstandes gehorchen; was darüber hinausgeht, ist zwar denkbar, aber dies nur im Sinne von „phantasierbar“ – wissenschaftlich erfassbar ist solches nicht. Dadurch macht Kant einen gewichtigen Unterschied zwischen dem Erkennen, das der Logik des Verstandes gehorcht, und dem reinen Denken, das den Verstand transzendiert, das sozusagen permanent aus seiner geordneten Struktur auszubrechen droht. Deshalb auch muss sich die Vernunft so ordnungsgebieterisch, grenzenkontrollierend gebärden: Sie muss darauf achten, dass die Triebe des Verstandes, der sowohl eine rezeptive wie eine spontane Komponente enthält, nicht unzulässigerweise in der Gedankenwelt umherschweifen und darin falsche Synthesen bewirken, falsche Schlüsse, Urteile oder Behauptungen. [28] Andererseits bedeutet Kants Konzeption nicht, dass die erkennbaren Dinge banal sein müssen, indem sie der allgemeinen Logik des Verstandes eines Jedesmenschen gehorchen; nichts spricht dagegen, dass sie kompliziert werden können, indem sie einer verknüpften Logik folgen. [29] Aber die Struktur der erkennbaren Welt ist identisch mit der Struktur des Verstandes, der Struktur der Verstandestätigkeit, der Logik seiner Operationen. Zwischen dem Verstand und der Natur herrscht ein logischer Determinismus – der nicht mit dem empirischen Determinismus verwechselt werden sollte, auch nicht mit dem Fatalismus oder mit dem theologischen Determinismus, wie er bei Leibniz facettenreich durchschimmert.
Kant begrenzt also den Bereich des gesicherten, gewissen und verbindlichen Wissens, den Bereich dessen, was erkennbar ist; das ist seine neue Art zu sagen, was das Wissen ermöglicht. [30] Ein wichtiger Punkt, der zu beachten ist, besteht darin, dass wir wissen, dass es neben der klassischen Physik eine moderne gibt, in welcher die klassische Kategorie der Kausalität nahezu zur Gänze außer Kraft gesetzt ist: radioaktive Teilchen lassen sich zwar technisch ausbeuten, nicht aber theoretisch beherrschen. Dieses Wissen, das wir Kant voraus haben, erschwert es uns, das Kantische System einigermaßen adäquat zu erfassen. Denn es war für Kant unmöglich, sich vorzustellen, dass die Newtonsche Physik, deren Möglichkeit seine Theorie insbesondere rechtfertigen soll, am Ende des 19. Jahrhunderts auf technisch nicht unproduktive Weise in eine Krise geraten würde, indem sie kritisiert werden konnte. Dieser Umstand hat zur Folge, dass alle Momente im Kantischen System starr und fixiert aufgefasst werden müssen, dass kein Moment in diesem veränderlich ist noch es mit veränderlichen Gegenständen zu tun hätte – selbst die Ethik, die Kritik der praktischen Vernunft, die die Freiheit der menschlichen Handlungen zum Thema hat, gipfelt in einer Strenge, die an Absurdität grenzt (was aber nicht heißt, dass der empirische Mensch Kant in moralischen Fragen verbohrt gewesen wäre). Kant fragt, wie die Newtonsche Physik aufgebaut sei, und er findet die wenigen Lehrsätze der Mechanik als Prinzipien dieser Wissenschaft vor. Diese nennt er Synthetische Urteile a priori. Sie haben dieselbe Funktion wie die Axiome in der Mathematik, nur sind sie eben Grundsätze einer Wissenschaft, die empirische Erkenntnisse über die Natur produzieren soll, wohingegen die Mathematik rein analytisch ist und im formalen Bereich verharrt. Wenn man also fragt, wie Synthetische Urteile a priori möglich sind, so fragt man danach, wie die Wissenschaft über das Sein als Natur aufgebaut ist, und man fragt zugleich, wie der Erkenntnisapparat überhaupt funktioniert. Das ist schwierig: Gibt es nun im Kantischen System einen Bruch zwischen dem Wissen im Alltag und dem wirklichen wissenschaftlichen Wissen – oder beschreibt die Erkenntnistheorie im gleichen Zug, wie auch das Alltagsbewusstsein auf verbindliches Wissen stoßen kann? Es lässt sich bei Kant noch nicht terminologisch exakt zwischen Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie unterscheiden, gerade deswegen vielleicht, weil er nicht sehen wollte bzw. konnte, in wieviele Einzeldisziplinen sich das wissenschaftliche Wissen auffächern würde (man darf auch daran erinnern, dass seine „eigentlichen“ Interessen weniger den „exakten Wissenschaften“ als der Moralphilosophie und den Fragen der dogmatischen Metaphysik galten). Kant meinte, die Grundsätze der Erkenntnis sind auch die Grundsätze der Wissenschaft, von der es immer nur eine geben könne, und diese müsse man sich – das hebt ihn radikal von Hume ab – jenseits jeder geschichtlichen Veränderung vorstellen. Das bedeutet letztlich, dass sich Alltagserkenntnis und Wissenschaft decken würden; und dies kommt dem Selbstverständnis entgegen, dass es ein und dasselbe ist, eine Theorie verbindlich abzusichern wie die Vernunft als vernünftig im ganzen zu rechtfertigen.
Da die Erkenntnisbedingungen allgemein sein müssen, spricht Kant nicht von empirischen oder substantiellen Erkenntnissubjekten, sondern von einem nicht konkretisierbaren transzendentalen Subjekt, in welchem sich der Prozess der Erkenntnis abspielt. Dieser verläuft so, dass die subjektiven, aber nicht psychologischen Bedingungen der Erkenntnis mit den objektiven Bedingungen der Gegenstände der Erkenntnis identisch werden. Das heißt, dass die Menschen nur das wissen können, was ihr Erkenntnisapparat präformiert, oder anders gesagt: der Verstand – nicht die Ideen und nicht die „Materie“ – schreibt der Natur die Gesetze vor. [31] Die grundlegenden Gesetze sind nicht einfach in der Natur vorfindbar, sondern müssen aus dem Verstand gefolgert werden (von da her das „a priori“), der nun aber nicht mehr wie bei Leibniz ein letztlich theologisches Schöpfungssubjekt wäre, sondern eine formallogische Struktur, die immer auf gleiche Weise funktioniert, wenn ein empirisches Subjekt – ein Mensch ohngeachtet seines Geschlechts, seiner Klasse oder seiner Kulturangehörigkeit – einen Gegenstand der Natur verbindlich und intersubjektiv vermittelbar erfassen will.
Die Synthetischen Urteile a priori sind Aussagen über Objekte, die Bestimmungen zu den letzteren enthalten, Bestimmungen oder Attribute, die nicht schon im Begriff dieser Objekte selbst enthalten wären, die aber nicht aus der empirischen Erfahrung im Zusammenhang mit diesen Objekten gewonnen werden, sondern prinzipiell Geltung haben müssen; es sind also allgemeine Gesetze wie eben Newtons Gesetz der Schwerkraft, das sich nicht empirisch herleiten lässt, aber auch nicht aus dem Begriff des Körpers rein definitorisch erschlossen werden kann. Newtons Gesetze sind also nicht-aposteriorisch entstanden, nicht aus der empirischen Erfahrung abgeleitet, beziehen sich aber auf Realexistierendes, weshalb sie auch nicht-analytisch sind. Das ergibt Kants monströsen Ausdruck der Synthetischen Urteile a priori, die nur von einem transzendentalen Erkenntnissubjekt gefunden werden können, das zugleich nicht-empirisch ist, sich aber auf die Natur bezieht.
Alle Einzelerkenntnisse gehören nur dann zur Wissenschaft, wenn sie in einem strengen Zusammenhang mit diesen Prinzipien stehen. Wird in der Methodologie von Deduktion gesprochen, so müsste streng genommen damit gemeint sein, dass Einzelaussagen, also Hypothesen, letztlich auf diese paar Gesetze Newtons reduzierbar wären.
Das verbindliche Wissen bezieht sich gleichzeitig auf die Synthetischen Urteile a priori wie auf die einzelnen Gesetze, die es durch analytische Verstandestätigkeit, durch Kombinatorik konstruierte, indem es die einzelnen Merkmale der Phänomene als identische getreu registrierte.
Die Platonische Dichotomie von Idee und Abbild erfährt bei Kant eine Besonderung, die ihr kritisches Potential hervorstreicht. Denn erkannt wird hier nicht mehr ein dem Alltag entrücktes Wesen, sondern die gesetzmäßigen, gesetzesmäßigen Zusammenhänge bloß der Merkmale der erscheinenden Phänomene, der Gegenstände, sofern sie sinnlich fassbar sind, die von ihrem Wesen, dem Wesen als Ding an sich, nur affiziert sind; was immer das Affizieren bedeuten mag – entscheidend ist, dass die Phänomene nicht in ihrem Wesen ihre Ursache haben sollen, dass umgekehrt die Ursache nur zwischen den Merkmalen der Phänomene wirkt, und sonst nirgends. Ebenso entscheidend ist aber, dass das Ding an sich um so mehr im Auge behalten werden muss, als es nicht als Wesen verstanden wird, als Identität. „Platonistisch“ wäre dann der erkenntnistheoretische Realismus, der in den Erscheinungen – den empirischen Daten – schon ihr Wesen zu erfassen vermeint, indem er ein kritisches Korrektiv gegenüber der Wahrnehmung verleugnet.
Der Begriff, der das Empirisch-Sinnliche und das rein Verstandesmäßige, das Ausgedehnte und das Denkende verknotet, ist, deutlich festgehalten erst in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, die Transzendentale Einheit der Apperzeption (bzw. des Selbstbewusstseins), hier bestimmt als der Tatbestand des „Ich denke“, das „alle meine Vorstellungen begleiten“ können muss. [32] Wie immer er auch konstruiert erscheinen mag – er ist ein massiv biologisches Fundament des Kantianismus und gibt zum Ausdruck, dass das gewöhnliche Denken, gleich wie das wissenschaftliche, in der Weise nicht-schizophren ist, als die unendliche Vielfalt nicht einfach als Chaos auf das empirische Ich hinzustürzt, sondern, sei das Bewusstsein konzentriert oder „zerstreut“ alltäglich, sich ohne Schwierigkeit in permanenter Kontinuität auf gestaltete Einheiten ausrichtet. Gerade dass diese Basis biologisch ist, bedeutet, dass sie keine Funktion des empirischen und individuellen Bewusstseins sein kann, die sich in verschieden starken Ausprägungen manifestieren würde (davon wird sich vielleicht dann sprechen lassen, wenn die Funktionalitäten der Schizophrenie widerspruchsfrei dargestellt werden können): „(Das) empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des Subjekts.“ [33]
Ausgerechnet in der Nähe des naturwissenschaftlichen Biologismus wird die metaphysische Gier des Platonismus auch bei Kant fassbar: Der Philosoph will den Zusammenhang zwischen dem Determinismus oder Descartes' Res Extensa und der Freiheit des Willens oder Descartes' Res Cogitans als einen zwingenden darstellen; es genügt ihm nicht zu sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen der materiellen Objektivität und der vernünftigen Subjektivität gibt – er muss ihn als einen absolut zwingenden darstellen. Deshalb kann er nicht bei der Meinung stehen bleiben, dass das potentielle Chaos der menschlichen Handlungen in der Gesellschaft, das durch die Freiheit der Einzelhandlungen entsteht, durch eine wie auch immer repressive Ethik in politischer Hinsicht zur Diskussion gestellt, in Griff, d. h. zu Verstand und wo nötig zu Gesetz gebracht werden könnte; der Primat der Kausalität im Verstand wird auf eigentümliche Art in den Bereich des freien Willens übertragen, verschoben und fahrlässig ausgedehnt. Dieser ist nach Kant nur dann menschlich und gut zugleich, wenn er sich in Abhängigkeit des Kategorischen Imperativs zeigt: du sollst nicht handeln, weil du findest, eine Handlung sei gut – also aus Neigung – sondern handle deswegen, weil du der Pflicht gehorchen willst, wenn diese auch bloß aus dem Gesetz besteht, das du dir selbst gegeben hast. [34] Kant spricht von der Kausalität aus Freiheit, wenn dem Formalen der Ideen des Guten gefolgt wird – hier ist das Bindeglied zwischen Platon und der abschreckenden Strenge des Kategorischen Imperativs. Der Platonismus ist im transzendentalen Idealismus nur insoweit verdeckt, als die Ideen dem Gesetz, das aus Autonomie gesetzt ist und das die Pflicht bestimmt, nachgeordnet sind. [35] Die Freiheit in der Gesetzgebung hat nur die eine Funktion, deren Disziplinierungskraft ungeschmälert sich entfalten zu lassen. [36]
Die Brücke zwischen dem Verstand und dem Willen ist die Intelligenz. Die Kritik der Urteilskraft verbindet die Kritik der reinen Vernunft mit der Kritik der praktischen Vernunft. Ob ein Mensch intelligent sei, zeigt sich in seiner Fähigkeit oder in seinem Vermögen, d. h. in seiner Urteilskraft, Kunstwerke zu beurteilen oder das Zweckmäßige in der Natur bzw. in einem handlungstheoretisch problematischen Zusammenhang wahrzunehmen. Diese Wahrnehmungskraft im Einzelmenschen ist Bedingung der Möglichkeit zur Erfassung logisch-analytischer Operationen, die selbst die Grundlage für die Wissenschaft abgeben.
Das Wissen muss bei Kant in einem puristischen Sinn geschichtslos sein, weil das transzendentale Subjekt mit seinem konstruktiven Apparat geschichtslos ist, der neben den zwei Anschauungsformen Raum und Zeit zwölf Kategorien enthält: Einheit, Vielheit, Allheit, Realität, Negation, Limitation, Inhärenz, Kausalität, Gemeinschaft, Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit. [37] Das bedeutet, dass es Erkenntnis nur von „toten“ Gegenständen gibt und dass es keine wirkliche Verbindung über dem tosenden Abgrund zwischen dem bürokratischen Reich des Seins und dem polizeilich dominierten des Sollens gibt – außer dem dünnen Steg der Intelligenz – so dass es kein demokratisches Wissen, das die Bürger zur Regulierung ihrer Gesellschaft in entscheidendem Ausmaße einsetzen könnten, geben kann, geben darf. [38]
In unvorstellbar kurzer Zeit und also quasi in Überstürzung nach dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft – 1786 erscheinen Reinholds Briefe über die Kantische Philosophie, ein Jahr später Jacobis David Hume über den Glauben oder Idealismus und Realismus – wechselt diese absolutistisch-mechanische Form der Frage, was Wissen sei in die historisch-dynamische der Dialektik. Insbesondere wurde das Ding an sich sofort zu einem Skandal, da es zwar notwendig ist, damit das transzendentale Subjekt Erscheinungen mittels den Anschauungsformen Raum und Zeit erfahren kann, Erscheinungen, die durch irgend etwas überhaupt zur Erscheinung gebracht werden müssen; andererseits ist diese ursächlich-kausale Abhängigkeit unmöglich, da sie selbst eine Erscheinung sein müsste, wenn sie kausal wirkt, weil bekanntlich die Kategorien nur innerhalb des Bereiches der erkennbaren Erscheinungen wirken – außerhalb dieser Umzäunung ist der Bereich der unendlichen Transzendenz. Das Ding an sich ist somit ein Nichts, das das Alles bewirkt (die Dinge zum Erscheinen bringt); das musste nach „Materialismus“ und Nihilismus geradezu penetrant riechen. Wie Leibnizens Monadologie aus einer relativ bescheidenen Sachfrage Descartes' herauswuchs, so entwächst auch die Hegelische Dialektik aus einem Fragegestrüpp, das im nachhinein relativ einfach zu benennen ist, für die damaligen Zeitgenossen aber recht verzweifelt anmutete. Ich will damit ausdrücken, dass in der Frage der Entstehung der Dialektik es eine bloße Einseitigkeit wäre, würde sie auf ideologische Motive reduziert werden: auf das christliche Bild der Schöpfung, auf die bürgerliche Rechtfertigung der politischen Ordnung, die auf der schwankenden Brücke eines Antagonismus ruht. In dem gegebenen Rahmen genügt es aber vollauf, sich auf die ausgereifte Form der Dialektik zu beschränken, ihre Entstehung und ihren Bezug auf Kant (und Fichte) außer Acht zu lassen; die Phänomenologie des Geistes wird 1808 publiziert, das sind doch ganze 27 Jahre nach dem Erscheinen der Erstauflage der Kritik der reinen Vernunft.
Bei Hegel (1770-1831) bilden sich die Gestalten des Wissens an dem Objekt selbst heraus, wovon das Wissen eben Wissen sei. Indem das Erkenntnissubjekt das Ungenügen oder das dialektisch Widersprüchliche in seinem intellektuellen Verhalten gegenüber dem Objekt der Erkenntnis reflektiert, ist es befähigt, die Widersprüche zu überwinden; es macht nichts anderes, als diese immer wieder von neuem begrifflich zu benennen. Die Frage, was das Wissen gegenüber dem Glauben sei, tritt nun in den Hintergrund (d. h. sie wird verwischt, Kants Grenzziehung bespottend) zur bevorzugteren Artikulierung der Frage, wie sich das Wissen bildet: im Einzelbewusstsein phänomenologisch, im Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis der Menschheit historisch – in gewisser Hinsicht bei Hegel also bereits gesellschaftlich, in einer noch zu präzisierenden: metaphysisch. Hegel fragt nicht, was das Wissen seinem Wesen nach oder strukturell ist, sondern wie es sich bildet. Kants Wahrheitsbegriff ist in dieser Hinsicht noch mittelalterlich-scholastisch, weil er der adaequatio rei et intellectus so folgt, dass die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis im Intellekt zugleich – adäquat – die Bedingung der Möglichkeit der Wirklichkeit des Gegenstandes der Erkenntnis – der Sache – sei, oder anders: die Form des Bewusstsein von etwas ist dasselbe wie die Struktur der Sache. Das Hegelsche Wissensverständnis geht darauf hinaus, dass – nicht ohne religiöse Prätention – das absolute Wissen substantiell zu sich selbst komme, nichts anderes sei als die Wiederaneignung seiner substantiellen – nicht formellen – Entäußerung und dass darüber hinaus eine andere Vorstellung von Wissen undenkbar sei, weil es im innersten zu seiner Bestimmung gehöre, sämtliche denkbaren vermittelt in sich aufgehoben zu haben (empirischen, theoretischen, ästhetischen…). Die Hegelische Aussage, dass das absolute Wissen zu sich selbst kommt, ist nicht dieselbe der Antike, des Mittelalters oder bei Leibniz, die sagt, Gott selbst sei das absolute Wissen, als das Gute, die Allwissenheit oder die Urmonade; Hegel sagt, dass es in einem Prozess zu sich kommt, dessen Zweck und Ende man als seine Finalität oder sein Telos begrifflich artikulieren könne (was Leibniz mit der Universalsprache halbwegs auch intendierte – aber es fehlt der systematische Zusammenhang, die begriffliche Bruchlosigkeit).
Kants Ich, das alle meine Vorstellungen begleiten soll und das seiner Philosophie so viel Plausibilität verleiht, nicht zuletzt dank der biologisch-strukturalen Verankerung, wird einerseits nun spekulativ hergeleitet, entwickelt, andererseits nicht nur als gesellschaftliche Kategorie konkretisiert, die den Antagonismus repräsentiert, als knechtisches bzw. herrisches Selbstbewusstsein, sondern im gleichen Zug dogmatisch als Moment des Geistes bestimmt, der die Widersprüche sowohl formt, zur Erscheinung anreizt wie vormals das Ding an sich, sie aber auch, was jenes geradezu blockierte, glättet, indem er sie zum bloßen Allerlei stilisiert, das hinwiederum Besonderes nur schwer sich entfalten lässt.
Nachdem wir phänomenologisch zugeschaut haben, wie in der Empfindung das empirische Erkenntnisobjekt nur dadurch seine Evidenz – und Relevanz – behält, dass es sich verinnerlichen lässt – im trotzigen Beharren auf dem faktischen Hier und Jetzt drohte seine Verflüchtigung – geht seine Beschaffenheit zwar nicht verloren, erhält aber deren Wert ausschließlich durch die strukturierende Aufmerksamkeit der subjektiven Seite. Diese ist nun keine feststehende, überzeitliche und transkulturelle Struktur mehr, eingelassen in eine Tafel unveräußerlicher Kategorien; sie führt von der (als örtlich und zeitlich festgeketteten Empfindung bereits angesprochenen) sinnlichen Gewissheit [39] zum Begriff der Wahrnehmung (93), in der das Allgemeine der Dinge und deren Eigenschaften auf dem Prüfstand ist, entschlackt von den Pertuberanzen der zeitlichen und örtlichen Unendlichkeiten. Doch sind die Dinge der Wahrnehmung begrifflich immer noch Phänomene, Erscheinungen, und sie unterstehen „der Möglichkeit der Täuschung“ (97). Es ist die Funktion des Verstandes (107), das Innere der Dinge, ihre Substanz oder ihr Wesen zu betrachten. Dieses Innere erscheint als Kraft (110) – beziehungsweise, und das ist kein geringer Trick in Hegels Frühwerk, als Begierde (139): Die Kraft hinter den Dingen ist auch meine Begierde, die auch die anderen Verstandesbewusstseine haben.
Die Begierde ist ein Effekt der Tätigkeit des Verstandes, des Sichbeziehens auf etwas – also auch auf sich selbst; als solche ist sie keine bloße Kraft, in der die Unendlichkeit fungieren könnte, sondern ein Bestreben, das, insoweit es ihm allein um sich selbst geht, „ihm wesentlich sein (muss)“ (ebd.). Darf beim Begriff der Kraft und der Kräfte das Spiel assoziiert werden, so geht es der Begierde das, was das Kräftespiel regulierte, außer Kraft gesetzt ist, das Gesetz, die Gesetze (es ist sowohl immer ums Ganze – es geht um Leben und Tod. Und dieser Kampf ist dadurch bestimmt, dass an den Kant der Naturwissenschaft wie an den der Moralphilosophie zu denken).
Die anfängliche Tätigkeit des Bewusstseins ist nun eine des Selbstbewusstseins, und dies allein dadurch, dass es der Tätigkeit anderer Bewusstseine sowohl passiv ausgesetzt ist wie sie auch aktiv wahrnimmt. Da diese Tätigkeit aufs Ganze geht, bedarf sie eines Aktionsfeldes, das sie sowohl zu sich selbst kommen lässt – befriedigt – wie auch am weiteren Wirken aufrechterhält. Dies ist das Feld der Anerkennung. Die Dialektik der Anerkennung wird im folgenden dargestellt als Analyse der Dialektik, gegen die Adornos negative zwar nicht der Herkunft nach, um so mehr in ihrer Intention, opponiert.
Der Begriff der Anerkennung setzt eine Entzweiung voraus, die vorerst offen lässt, ob sie in ein und derselben Identität geschieht oder eine zweite, zusätzliche nach sich zieht. Das, was durch die Wahrnehmung der Begierde in der Anerkennung steht, will anerkannt werden, und es weiß, dass es dies noch nicht ist. Also muss in der Entzweiung etwas entstehen; eine treibende, zugleich motivierende wie zweckesetzende Dynamik ist für die Dialektik konstitutiv. Es ist dies ein Tun der einen Seite gegen die andere, und zwar wechselseitig und in dieser Vorläufigkeit symmetrisch.
In der Anerkennung gibt es für das Selbstbewusstsein, von dem die Rede ist, ein anderes Selbstbewusstsein. In Anlehnung an Lacan, mit dem Hintersinn, Kant und Hegel nur soweit zu trennen, wie es in der Tat unvermeidlich ist, sei für einen Moment der Begriff des Selbstbewusstsein so dünn wie möglich verstanden, als das, was er seit Leibniz bedeutete, Apperzeption, d. h. Empfindung, die dank des Ichbewusstseins gegenüber der einfachen Perzeption deutlich artikuliert werden kann. Das dynamische ich (je) kann sich selbst als Ich (moi) zum Gegenstand machen; das Selbstbewusstsein ist in dieser Form „außer sich gekommen“: es hat im selben Akt sich „verloren“ und das Andere, die Idee des Anderen aufgehoben, da in dieser gesetzten Entzweiung das Andere ja das Ich selbst ist (vor diesem Akt hat es das Andere als Form nicht gegeben, in ihm wird es negiert: das Andere steht in der idealistischen Dialektik a priori auf einem gefährdeten Posten). Dieser Zustand, wahrgenommen als Verlorenheit, muss, sofern die darin bewirkte Träumerei einen schlechten Ausgang zu nehmen droht, aufgehoben werden, indem das Verlorene, Entäußerte am Ich (moi) aufgehoben wird; zugleich muss aber auch das ich selbst (das je) aufgehoben werden, denn das Andere, das Ich, ist es selbst. Dieser negativen, negierenden Seite der Aufhebung ist eine positive beigestellt, durch die „Rückkehr in sich selbst“ (146), in der die Erfahrung mit der Andersheit verarbeitet aufbewahrt wird, in dem Sinn, dass das einzelne Ich seiner selbst gewiss geworden ist. – Hegel führt diesen Ansatz nicht zu Ende. Ich meine aber, an dieser Stelle eine der Vorstellungen von Subjektivität herauszuspüren, die nicht die katastrophische Form hätte annehmen müssen, die sie im Folgetext angenommen hat, wenn Hegel bei dieser Passage das kommende Drama nicht als fixe Idee bereits festgelegt gehabt hätte, auf das dann alles Vorhergehende hinzusteuern musste. Der Abschnitt zum Stoizismus, zum Skeptizismus und zum unglücklichen Bewusstsein versucht, diesen Faden wieder aufzunehmen, doch ist das Dazwischenliegende zu dominierend, als dass die Bemerkungen sich einem aufgesetzten Schematismus zu entziehen vermöchten.
Wird der Begriff des Anderen ins Zentrum gerückt, so kann der Prozess der Anerkennung nicht mehr in einer singulären Identität vonstatten gehen. [40] Denn vom Ich (moi) als dem Anderen des ichs (je) kann nicht dasselbe aktive Entäußern erwartet werden (nur blockierende, verdinglichende Störungen). Die Anerkennung ist ein wechselseitiger Prozess, in dem das Tun des Einen gegen den Anderen auch das Tun des Anderen gegen den Einen ist. „(Es) tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf.“ (148) Was sich in der Analyse verändert hat ist, dass jetzt diese Individuen je für sich ihrer selbst gewiss sind, „aber nicht des anderen, und darum hat (ihre) eigene Gewissheit von sich noch keine Wahrheit“ (ebd.).
Die Momente im Prozess des Anerkennens sind nun „(herausgetreten aus der Mitte) in die Extreme, welche als Extreme sich entgegengesetzt sind und von welchen das eine nur Anerkanntes, das andere nur Anerkennendes ist“ (147): In der idealistischen Dialektik stehen das Identische und das Nichtidentische in einem oppositionellen, gegensätzlichen Verhältnis, deren Wertungen zwar abgetauscht werden können, immer sich aber gegeneinander richten.
In der wechselseitigen Anerkennung müssen sich die beiden auf Tod und Leben bewähren, da jeder dem Anderen ein Gegenstand ist, in dem er „außer sich gekommen“ ist, welche Verlorenheit, welches Anderssein, aufgehoben werden muss. Das ist – sofern der Tod selbst vermieden werden soll – einerseits möglich durch Verachtung, Zynismus und Abschätzigkeit des Andersseins bzw. gegenüber dem Anderen und/oder durch Souveränität, Egoismus und Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst, andererseits durch Hochschätzung des Lebens im neurotischen Sinn der Furcht vor dem Tod und/oder Verminderung der Achtung gegenüber sich selbst.
Nach dem Kampf bleiben zwei Gestalten: ein reines Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein, welches für ein anderes Bewusstsein da ist. Dem Herrn ist seine Selbständigkeit wesentlich, das Lebendige nichtig, ja, er würde den Kampf fortsetzen und lieber den Tod auf sich nehmen, als sich zu unterwerfen; dem Knecht ist das Leben wichtiger und die kleinen Unterschiede im Lebendigen. Das bedeutet, dass diejenige Form im Gang der Anerkennung, die die Erfahrung mit dem Tod gemacht hat, sich in zwei Formen aufspaltet, von welchen die eine weiterhin so tun kann, als gebe es keine Erfahrung des Todes, als gebe es eine List im Umgang mit ihm; die andere interessiert sich für die Gestaltung des Lebendigen, um nichts über den Tod sagen zu müssen, um ihn verdrängen zu können.
Es wäre unmöglich, dass sich die beiden Formen als verschiedene auf gleichgültige Weise akzeptieren würden; sie stehen zueinander in einem oppositionellen Verhältnis und müssen in einer verzwickten Beziehung zueinander diese durchstehen. Der Herr bezieht sich als Fürsichsein in seiner Souveränität zunächst auf sich selbst, dann auf dreifache Weise auf das Andere: a) unmittelbar abschätzig auf den Knecht und das Leben, b) vermittelt durch das Leben, das er genießt, auf den Knecht, der es ihm verschönert und c) vermittelt durch den Knecht, den er für seine Zwecke einsetzt, auf das Leben, dessen Genüsse er wählt. Als Fürsichsein negiert sich der Knecht, er fühlt sich alles andere als munter und selbstbewusst; die Negation wird durch den Herrn noch verdoppelt, unnötigerweise, aber dialektisch systematisch: wer nicht nach oben will, der wird noch nach unten gestoßen.
In dieser Anerkennung herrscht insoweit der Mangel, als weder der Herr sich selbst negiert, kritisiert, in Frage stellt, noch denselben Herrn der Knecht. Die Anerkennung misslingt, und sie realisiert sich nur in diesem Misslingen.
Doch das ist bloß die empirische Realität und keineswegs das, was die dialektisch totale Wirklichkeit ausmacht. Im Anerkennen geht es darum, dass die Gewissheit seiner selbst zur Wahrheit wird. Der Herr kommt sich nicht nur auf selbstherrliche Weise als Herr vor, sondern es sagt auch der Knecht von sich aus, dass der Herr auf gebührende Weise Herr ist. Deshalb liegt für den Herrn die Wahrheit seiner Gewissheit – die Bestätigung seiner Selbstgewissheit – im unwesentlichen Bewusstsein. Folglich ist auch er, der Selbständige, abhängig – abhängig vom Knecht, auf den er zwar Einfluss hat, dessen Unselbständigkeit dem Einfluss aber eine entscheidende Grenze setzt. Sie führt dazu, dass der Herr weder im Knecht noch in der Magd seine Befriedigung finden kann, sondern in Isolation entweder durch den Konsum von Luxusgütern verdummt oder neue Herausforderungen, neue Schlachtfelder immer wieder von neuem finden muss. [41]
Als zurückgedrängtes Bewusstsein geht der Knecht in sich – die Begriffe Erniedrigung, Bescheidenheit, Vernünftigkeit und Subjektivität liegen offenbar nahe beieinander – und entpuppt sich als wahre Selbständigkeit, als Selbständigkeit an sich. Denn er hat sich eingerichtet, sei es durch Anbiederung oder Anpassung, und er produziert bedeutsame Gebilde, die von ihm zeugen.
Außer reines unselbständiges Bewusstsein ist der Knecht auch Selbstbewusstsein, und deshalb zunächst für den Herrn auch wesentlich. Der Knecht hat die Erfahrung gemacht, dass seine eigene Wahrheit reine Negativität ist, dass er im Kampf mit anderen Selbstbewusstseinen getötet würde; er hat die Furcht vor dem Tod empfunden, „des absoluten Herrns“ (153). In dieser Angst ist er aufgelöst: „Diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einfache Wesen des Selbstbewusstseins, die absolute Negativität, das reine Fürsichsein, das hiermit an diesem Bewusstsein ist.“ (Ebd.) Im Dienen ist das reine Fürsichsein real und die momentane Abhängigkeit vom Dasein – als Angst vor Arbeitslosigkeit – aufgehoben.
Die Angst vor dem Tod wechselt zur Furcht vor dem Herrn, wo das Bewusstsein nur Gegenstand ist, kein Fürsichsein. In der Arbeit, der konkreten Form des Dienens, kommt es zu sich selbst. Arbeit ist gehemmte Begierde – die Begierde des Herrn ist demgegenüber reines, ungehemmtes Negieren des Gegenstandes. In der Befriedigung der Begierde des Herrn ist folglich kein Bestehen, weil keine gegenständliche Seite da ist, nur der Genus. In der Arbeit ist die gehemmte Begierde ein aufgeschobenes Negieren, in welchem der Gegenstand des Negierens bestehen bleibt, als geformter, gebildeter, artikulierter Gegenstand. Nur im knechtischen Bewusstsein hat das Sein als Gegenstand auch Selbständigkeit, das zu gestalten man ein Interesse aufbieten kann. In der Arbeit wird das Fürsichsein des Bewusstseins empirisch wirklich und real. Der Knecht sieht im Produkt der Arbeit sein eigenes selbständiges Sein.
Aber in der bildenden Arbeit wird nicht nur das Fürsichsein ein wahres und wirkliches Ansichsein. Das knechtische Bewusstsein ist in seiner Unselbständigkeit auch Furcht. Gegen diese Furcht hat das Formieren auch eine negative Seite: Im Bilden wird die Negativität des Arbeiters umgeformt, indem der Arbeiter das ihm Fremde, das die Angst auslöst, umformt. Das Negative des Gegenstandes war der Herr, vor dem er „gezittert“; als absoluter Herr ist der Herr das Sein wie auch die Herrschaft. Hegel schreibt:
Im Herrn ist (dem Knecht) das Fürsichsein ein anderes und nur für es; in der Furcht ist das Fürsichsein an ihm selbst; in dem Bilden wird das Fürsichsein als sein eigenes für es, und es kommt zum Bewusstsein, dass es selbst an und für sich ist. Die Form wird dadurch, dass sie hinausgesetzt wird, ihm nicht ein Anderes als es; denn eben sie ist reines Fürsichsein, das ihm darin zur Wahrheit wird.“ (154)
Das, würde ich meinen, ist ein aussagekräftiges Zentrum zur Bestimmung der Metaphysik. Denn was immer in ihr auch formuliert wird und welche Formen sie annehmen kann: sie ist das affirmative Verhältnis zu den Bildungsgütern der abendländischen Geschichte. Der Knecht wird verklärt, indem die Arbeit immer schon in die Nähe des Geistigen, Unkörperlichen situiert und dadurch stilisiert wird. Die Totalität seiner Gebilde als die Gebilde des Geistes bilden die Vernünftigkeit aus, die zum Selbstbewusstsein und der Begierde steht wie der Verstand zum Bewusstsein und der Kraft bzw. dem Gesetz. Danach sind der Geist und die Geschichte, die Offenbarung und schließlich das absolute Wissen, das das Ganze zusammenfasst, nur milde Zugaben, die die Dialektik, das Erkenntnistheoretische bzw. Methodologische und das Metaphysische weder verdeutlichen noch relativieren.
1.3 Gesellschaft, Macht, Wissen (Marx)
Die bis hierher aufgezeichnete Folie sollte in ihren Schichtungen und Vernetzungen griffig genug sein, damit die folgenden Ausführungen als unterschiedliche Versuche der Distanzierung zu ihren Gehalten begriffen werden können, was auch den ganzen Adorno mit einschließt, dessen eigene Distanzierung nur insoweit eine besondere ist, als sie die größtmögliche der Zeit zu artikulieren versucht. [42]
Es sind nur zwei Passagen, die die Marxsche Bedeutsamkeit ins klärende Licht rücken sollen. Die eine stammt aus den Pariser Manuskripten von 1844 und betrifft die dezidierte Haltung gegen das Metaphysische bei Hegel, retrospektiv, die andere, nicht minder berühmte, nichtsdestotrotz vielvergessene steht in den Grundrissen und zielt auf Methodisches, prospektiv. Beide Passagen werden durch den Marxismus als „Lehre“ vermittelt, wie er im ersten Viertel der Deutschen Ideologie erscheint.
Es ist darauf zu achten, dass Marx sich zwar deutlich gegen Hegel wendet, dass es ihm aber bei den ersten Anläufen keineswegs gelingt, den metaphysischen Knoten befreiend zu durchschlagen. Bloße Ablehnung einer Position schützt nicht vor den Falschheiten, von denen sie getragen wird.
“Ein doppelter Fehler bei Hegel.
Der erste tritt in der Phänomenologie als der Geburtsstätte der Hegelschen Philosophie am klarsten hervor. Wenn er z. B. Reichtum, Staatsmacht etc. als dem menschlichen Wesen entfremdete Wesen gefasst, so geschieht dies nur in ihrer Gedankenform… Sie sind Gedankenwesen – daher bloß eine Entfremdung des reinen, d. i. abstrakten philosophischen Denkens. Die ganze Bewegung endet daher mit dem absoluten Wissen. Wovon diese Gegenstände entfremdet sind und wem sie mit der Anmaßung der Wirklichkeit entgegentreten, das ist eben das abstrakte Denken. (…) Die ganze Entäußerungsgeschichte und die ganze Zurücknahme der Entäußerung ist daher nichts als die Produktionsgeschichte des abstrakten, i. e. absoluten Denkens, des logischen spekulativen Denkens. Die Entfremdung (…) ist der Gegensatz von an sich und für sich, von Bewusstsein und Selbstbewusstsein, von Objekt und Subjekt, d. h. der Gegensatz des abstrakten Denkens und der sinnlichen Wirklichkeit oder der wirklichen Sinnlichkeit, innerhalb des Gedankens selbst. Alle anderen Gegensätze und Bewegungen dieser Gegensätze sind nur der Schein (…).“
Und weiter:
„Die Aneignung der zu Gegenständen und zu fremden Gegenständen gewordenen Wesenskräfte des Menschen ist also erstens nur eine Aneignung, die im Bewusstsein, im reinen Denken, i. e. in der Abstraktion vor sich geht, die Aneignung dieser Gegenstände als Gedanken und Gedankenbewegungen, weshalb schon in der Phänomenologie – trotz ihres durchaus negativen und kritischen Aussehens und trotz der wirklich in ihr enthaltenen, oft weit der späteren Entwicklung vorgreifenden Kritik – schon der unkritische Positivismus und der ebenso unkritische Idealismus der späteren Hegelschen Werke – diese philosophische Auflösung und Wiederherstellung der vorhandenen Empirie – latent liegt, als Keim, als Potenz, als Geheimnis vorhanden ist. Zweitens. Die Vindizierung der gegenständlichen Welt für den Menschen – (…) – diese Aneignung oder die Einsicht in diesen Prozess erscheint daher bei Hegel so, dass die Sinnlichkeit, Religion, Staatsmacht etc. geistige Wesen sind; denn nur der Geist ist das wahre Wesen des Menschen, und die wahre Form des Geistes ist der denkende Geist, der logische, spekulative Geist. (…) Die Phänomenologie ist daher die verborgene, sich selbst noch unklare und mystifizierende Kritik.“ [43]
Das entscheidende Statement gegen Hegel findet sich in einem Zusammenhang, der bereits das konstruktive Neue in ersten Zügen formuliert, allerdings noch stark an Feuerbachs Anthropologismus orientiert; dieser rückt zwar den wirklichen, sinnlichen Menschen ins Zentrum der Geschichte, muss aber um so mehr von der kritisierten Metaphysik übernehmen, je wesentlicher er den Menschen bestimmen will. Es handelt sich um den Abschnitt Die entfremdete Arbeit. Ausgangspunkt sind „die Voraussetzungen der Nationalökonomie“, „ihre Sprache und ihre Gesetze“; sie führen zur Reduktion aller widersprüchlichen ökonomischen Gestalten „in die beiden Klassen der Eigentümer und der eigentumslosen Arbeiter“ (50f). In Analogie zu Hegels Herrschaft und Knechtschaft beschreibt Marx das Verhältnis des Arbeiter-Knechts gegenüber seinem Produkt. [44]
Der Paukenschlag behält Hegels Telos, das geschichtlich-geschichtsphilosophische Subjekt unbeschadet, wertet es aber um: „Der Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu.“ (52) Unter diesen Vorzeichen werden alle Einzelmomente sowohl im Begriff der Entäußerung wie dem der Entfremdung negativ, ihre Unterscheidung dunkel, weil zu dieser Zeit zwischen Waren- und sonstigen Produkten überhaupt nicht, später trotz der präzisen Warenanalyse innerhalb des ökonomischen Produktions- und Reproduktionsprozesses nur sehr large unterschieden wird (was insgesamt im Marxismus die Überbauphänomene – seien es demokratische Institutionen oder Gebilde der Kunst – zur Deutung wenig anreizt).
1. „Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber.“ (Ebd.)
2. Zur Entäußerung gehört, „dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d. h. nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und seinen Geist ruiniert. (…) Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie nicht sein eigen, sondern eines anderen ist (…).“ (55)
3. „Die entfremdete Arbeit macht (…) das Gattungswesen des Menschen, sowohl die Natur als sein geistiges Gattungsvermögen, zu einem ihm fremden Wesen (…).“ (58)
4. Als letztes folgt „die Entfremdung des Menschen von dem Menschen.“ (Ebd.)
Gleich anschließend die Zeilen, die wegen der Elemente Mythos und Natur auch fürs Verständnis des jungen Adorno von Bedeutung sind, wenn diese bei ihm auch unabhängig von Marx entwickelt wurden, durch ihn bloß eine Bestätigung erfuhren (wichtig ist nur das Zusammentreffen der Elemente Herrschaft, Mythos und Natur, das in der Analyse der Verdinglichung im Kapital als gänzlich überwunden erscheint, weil es auf „das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis“ reduziert werden kann, das sich „kontrollieren“ lässt [45] ):
“Wenn das Produkt der Arbeit mir fremd ist, mir als fremde Macht gegenübertritt, wem gehört es dann?
Wenn meine eigene Tätigkeit nicht mir gehört, eine fremde, eine erzwungene Tätigkeit ist, wem gehört sie dann?
Einem anderen Wesen als mir.
Wer ist dieses Wesen?
Die Götter? Allerdings erscheint in den ersten Zeiten die Hauptproduktion, wie z. B. der Tempelbau etc. in Ägypten, Indien, Mexiko, sowohl im Dienst der Götter, wie auch das Produkt den Göttern gehört. Allein die Götter allein waren nie die Arbeitsherren. Ebenso wenig die Natur. (…)
Das fremde Wesen, dem die Arbeit und das Produkt der Arbeit gehört, in dessen Dienst die Arbeit und zu dessen Genus das Produkt der Arbeit steht, kann nur der Mensch selbst sein. (…)
Man bedenke noch den vorher aufgestellten Satz, dass das Verhältnis des Menschen zu sich selbst ihm erst gegenständlich, wirklich ist durch sein Verhältnis zu dem anderen Menschen. Wenn er sich also zu dem Produkt seiner Arbeit, zu seiner vergegenständlichten Arbeit, als einem fremden, feindlichen, mächtigen, von ihm unabhängigen Gegenstand verhält, so verhält er sich zu ihm so, dass ein anderer, ihm fremder, feindlicher, mächtiger, von ihm unabhängiger Mensch der Herr dieses Gegenstandes ist.“ [46]
Der Übergang zum reifen, materialistischen Marx wird von einer Schnittstelle beherrscht, die recht viel Unfug in Gang gesetzt hat, indem sie zur Lehre verkommen konnte, die aus diesem Grund heute nur zuviel Schrecken und Terror zu verantworten hat. Sie hat auch zu verantworten, dass das, was in der gerade zitierten Stelle als eher diffuse Macht dasteht, im Kapital eben zu leichtfüßig als kontrollierbar ausgegeben wird.
Die deutsche Ideologie war, zusammen mit Engels, im direkten Anschluss an die Pariser Manuskripte verfasst worden, 1845-46; 1932 erfolgt die deutsche Erstveröffentlichung, im gleichen Jahr der Pariser Manuskripte, die in Auszügen schon während der Zwanziger Jahre bekannt waren. Ihr Gegenstand ist „ein interessantes Ereignis: (der) Verfaulungsprozess des absoluten Geistes“ [47] . In Erinnerung der Pariser Manuskripte darf aber nicht eine präzisere Phänomenologie der Arbeit erwartet werden (… zur Entäußerung gehört, dass der Arbeiter seinen Geist ruiniert…); zur Debatte stehen vielmehr die Hegelkritiker Feuerbach, Bauer und Stirner, also nicht die Wirklichkeit in irgendeiner Art, sondern in der spezifischen, vermittelten der konkreten Form literarisch-theoretischer Gebilde. Was diese Theoretiker vereinigt, ist der Umstand, dass sie nicht nur deutsch und philosophisch schreiben, sondern dass „ihre sämtlichen Fragen sogar auf dem Boden eines bestimmten philosophischen Systems, des Hegelschen, gewachsen (sind)“ (18f). „Keinem von diesen Philosophen ist es eingefallen, nach dem Zusammenhange der deutschen Philosophie mit der deutschen Wirklichkeit, nach dem Zusammenhange ihrer Kritik mit ihrer eignen materiellen Wirklichkeit zu fragen. – Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, (…) sind (…) auf rein empirischem Wege konstatierbar.“ An Stelle einer Feuerbachkritik, wie die Kapitelüberschrift nahelegt, wird die materialistische Geschichtsauffassung dargelegt. Ich halte mich kurz. Die ersten Begriffe sind Produktion, Lebensweise als Verkehr der Menschen untereinander, Arbeitsteilung und/bzw. Eigentum. Dann kommen das Bedürfnis, die Produktivkraft und die Reproduktion und der erste Lehrsatz, „dass diese drei Momente, die Produktionskraft, der gesellschaftliche Zustand und das Bewusstsein, in Widerspruch untereinander geraten können und müssen“ (32). Der Begriff der Entfremdung wird bereits nur noch gebrochen verwendet – „um den Philosophen verständlich zu bleiben“ (34) – verleitet bei der Bestimmung seiner Aufhebung nichtsdestotrotz zu dem metaphysischen Satz, dass „(der) Kommunismus empirisch nur als die Tat der herrschenden Völker `auf einmal' und gleichzeitig möglich (ist), was die universelle Entwicklung der Produktivkraft und den mit ihm zusammenhängenden Weltverkehr voraussetzt“ (35), auch zu dem nicht weniger katechetischen: „Das Proletariat kann also nur weltgeschichtlich existieren, wie der Kommunismus, seine Aktion, nur als `weltgeschichtliche' Existenz überhaupt vorhanden sein kann.“ (36)
Rückblickend erstaunlich dünn geraten erscheint der Abschnitt Über die Produktion des Bewusstseins; er verweist mehr auf Arbeitsteilung und Herrschaft, als dass er eine Theorie des Bewusstseins und des Scheins zu liefern vermöchte – Herrschaft wäre gemäß dieser Notate geradezu leicht durchschaubar. Nach der Geschichte der Formen der Arbeitsteilung bzw. des Privateigentums und der Integration der Produktivkräfte findet sich der nächste metaphysische und ethnozentrische Hauptsatz: „Alle Kollisionen der Geschichte haben also nach unsrer Auffassung ihren Ursprung in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und der Verkehrsform. (…) Die durch einen erweiterten internationalen Verkehr hervorgerufene Konkurrenz mit industriell entwickelteren Ländern ist hinreichend, um auch in den Ländern mit weniger entwickelter Industrie einen ähnlichen Widerspruch zu erzeugen (…).“ (73) Die Ursache von Konflikten, so wird in der Deutschen Ideologie suggeriert, ist immer empirisch gegeben, die Ursache von falschem Bewusstsein, und es ist ebenso gegeben, dass sie bereinigt werden kann, durch eine neuere Organisationsform, wenn der revolutionäre Kampf dafür auch als ebensolche Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Das Errichten einer neuen Organisationsform, neuer Produktionsverhältnisse wird als sozialtechnologische Entscheidung präsentiert, als Verwaltungsakt innerhalb einer zwar weitläufigen, nichtsdestoweniger beeinflussbaren Bürokratie.
Ein anderer Marx zeigt sich in den Grundrissen von 1857-59. Das Verfahren der Lehrsätze wandelt sich nun zur Methodenreflexion, die insbesondere der immanenten Deutung eine gewisse Rolle zugesteht, wenn sie nun auch nicht mehr sich an bloßen Textgebilden orientiert, sondern die ganze empirische Wirklichkeit ins Auge zu fassen hat.
Die Kategorie der Totalität oszilliert in ihrer Motivierung zwischen dem Kokettieren mit der spekulativen Dialektik und der Dialektik der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in der Deutschen Ideologie – an dieser Stelle übernimmt sie die kritische und selbstkritische Funktion von Kants Ding an sich: Die Totalität bewirkt die Erscheinungen, ohne Determinante zu sein, ohne als Ganzes erkannt werden zu können. „Die Gesellschaft als Ein einziges Subjekt betrachten, ist sie (…) falsch betrachten; spekulativ.“ [48]
„Hegel geriet (…) auf die Illusion, das Reale als das Resultat des in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden, und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen (…) nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete anzueignen, es als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der Entstehungsprozess des Konkreten selbst. (…) (Eine ökonomische Kategorie) kann nie existieren außer als abstrakte, einseitige Beziehung eines schon gegebnen konkreten, lebendigen Ganzen.“ (22)
Also: Begriffe, Kategorien, Erkenntnisse sind Momente „eines schon gegebnen, konkreten, lebendigen Ganzen“. Diesem Ganzen sind sie nachgeordnet. Im Erkenntnisprozess ist auch das Primäre – alles Primäre, Eigentliche, Wesentliche –abgeleitet. [49]
Die metaphysischen, geschichtsphilosophisch-teleologischen und ethnozentristischen Momente liegen bei Marx einerseits offen in den Texten, andererseits gaben die Parteienstreitigkeiten, die Marxismen, tragisches Zeugnis einer dogmatischen Lektüre. Ebenso deutlich ist in den Texten aber die Anstrengung erkennbar, von denselben wegzukommen; gelungen sind schließlich weder die Analysen, die in der Reproduktion des Kapitals sowohl die Waffenproduktionen, die modernen Bankaktionen und, umgekehrt, die Einflussmöglichkeit in den demokratischen Institutionen unberührt lassen, noch die Politik, die im Marxschen Namen fast durchwegs metaphysischen Formen huldigte – um so mehr aber der erkenntnistheoretisch-methodologische Ansatz: es wurde ein langer Marsch bis zur Einsicht, dass das Ganze des Gesellschaftslebens nicht auf einen Schlag erkennbar ist, dass es aber der Erkenntnis überhaupt zugänglich ist und im Prozess der Aufklärung, wie Kants anthropologische Schriften zeigen, nicht ausschließlich als Spielwiese philosophisch-phantasievoller Frivolitäten hinzuhalten verdammt ist.
1.4 Diskursformationen (Nietzsche/Foucault)
Zielt Marx' Hegelkritik auf Praxis, teils durch erneuerte metaphysische Stilisierung des europäischen, euroamerikanischen Proletariats als dem mehr oder weniger verborgenen Subjekt der Geschichte, teils durch methodische Selbstkritik situiert in gesellschaftliche Selbstaufklärung; und zielt Kierkegaards Metaphysikkritik gegen den Ausschluss des Gefühls und der Innerlichkeit bzw. der Subjektivität im Einzelmenschen, die desto mehr in einer metaphysikerneuernden Vergottung gipfelt, je mehr sie von jeder gesellschaftlichen Vermittlung abgetrennt wird – so zerschlägt Nietzsche als erstes und zentrales die Idee einer systematischen Theorie überhaupt, die die Wirklichkeit repräsentieren soll, sei sie begrifflich idealisiert als Ontologie oder hinter die Maske der Bescheidenheit – die bloße Methode – gesteckt als Erkenntnistheorie bzw. Wissenschaftstheorie.
In den vielen Nietzschelektüren, die er selbst provoziert, erweisen sich zwei einander entgegengesetzte Nietzsches als voneinander untrennbar: der vorpsychoanalytische bzw. metaphysische der Lehren gegen die Metaphysik – derjenigen des Willens zur Macht und der ewigen Wiederkehr des Gleichen – und der etwas chaotisch anmutende methodologische, fürs Adornoverständnis um so relevantere. Der zweite Nietzsche ist deswegen vom ersten verdeckt, weil er die Begründungen seiner Theoreme allein diesem überlässt. Erst der junge Adorno wird jeden Lehrcharakter aus solchen Theoremen herausspülen, schließlich sie in einer diskursiven, begrifflichen Gesellschaftstheorie zu verankern versuchen. [50]
Welches sind die Theoreme des methodologischen Nietzsche?
1. Die menschliche, an den Körper gebundene Vernunft steht der empirischen Welt nicht als logisch-intellektualistische Einheit gegenüber, aus der eine Erkenntnismethode ableitbar wäre, im Sinne einer transzendentalen Analytik. Was bis zu Kant, Hegel und Marx stets in einem Ergänzungsverhältnis stand – Voluntarismus und Intellektualismus – hat bei Nietzsche eine zumindest vordergründig eindeutig einseitige Fixierung: den Primat des Willens (man sieht, schon diese Formulierung ist Bestandteil des metaphysischen Schopenhauer-Lehrlings).
2. Was es von der Wirklichkeit zu erkennen gibt, sind ihre Symptome; von ihnen her kann auf den Zustand der Wirklichkeit, d. h. die Kräftedisposition medizinologisch-diagnostisch geschlossen werden – eine empirische, repräsentative und distanziert-objektivistische Erkenntnis kann aus solchem Schließen nicht entstehen.
3. Die Symptome erscheinen in produzierten, gestalteten, durchgestalteten Formen; sie sind teilweise verstellt oder entstellt – tragisch gescheitert – teilweise offen verhüllt, d. h. in offensichtlicher lächerlicher Verkehrung.
4. Die Symptome sind begrifflich-metaphorische Texte oder künstlerische und politische bzw. artistische Gebilde.
Ich möchte diese Theoreme nicht bei Nietzsche präzisieren, um der Suggestion zuvorzukommen, es ginge hier um ein neues, von allem Neurotischen entschlacktes Nietzschebild. Denn keine noch so unscheinbare Teilbehauptung dieser Theoreme ließe sich vom metaphysischen Nietzsche befreit in den Texten nachweisen. Um so klarer äußert sich Foucault über das, was in Punkt 3 mit dem Begriff der produzierten Formen gemeint ist, in denen die Symptome der Wirklichkeit, die Erscheinungen erscheinen. Die kleine Schrift „Die Ordnung des Diskurses“ ist auch heute noch lesenswert.
Es ist die Funktion der Ordnung des Diskurses, „sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen“ [51] . Foucaults analytisches Sprechen von Diskursformationen hat also zwei Ziele, zwei materialistische Tendenzen, und, darauf soll jetzt schon hingewiesen werden, diese beiden werden bei Habermas, man muss sagen: von neuem, unterschlagen. Die eine Tendenz ist quasi-positivistisch bzw. szientistisch, indem sie es zum Programm macht, distanziert und historistisch die Abwicklung von Formen zu beschreiben, innerhalb welchen soziale und wissenschaftliche qua soziale Äußerungen sich ereigneten. In diesem „Positivismus“ oder „Strukturalismus“, der keinem starken Einfluss Nietzsches nachzugeben scheint, entstanden die beeindruckenden historischen Werke zu Themen der Frühzeit des Kapitalismus: Wahnsinn und Gesellschaft, Die Geburt der Klinik, Die Ordnung der Dinge, Überwachen und Strafen. [52] Die andere Tendenz widmet ihre Aufmerksamkeit kritisch denselben Formen als Formanten der Macht, dieselbst in diesem Konzept durchaus diffus und alles andere als materialistisch begriffen sein mag. [53] In ihrem Licht steht der politische Foucault, als ein Sprachrohr von Minderheiten, dessen Stil breit zu wirken vermochte, indem er als vordringlichstes allem Einschüchternden, das nicht zuletzt die Parteimarxismen prägte, den Wind aus den Segeln bzw. aus den Gefolgschaft erheischenden Fahnen zu nehmen versuchte.
Zuerst zählt Foucault drei Begriffstypen auf, denen gegenüber es den Diskurs zu situieren gilt: das Verbot mit den thematischen Tabuisierungen [54] ; der Ausschluss bzw. die Grenzziehung, die soziale Gruppen typisiert (8); der Wille zur Wahrheit mit der auch sozial wirksamen Unterscheidung von Wahrem und Falschem (10).
Diese äußeren Prozeduren der Kontrolle, der Einschränkungen und der Produktionsbedingungen von Diskursen sind durch interne zu ergänzen: das Verhältnis Primärtext - Kommentar (16), dasjenige von Text und Autor (19) und das begrifflich-metaphorische Regelsystem in den Disziplinen (21).
Eine dritte Gruppe von Regeln sorgt dafür, dass nicht „jedermann Zugang zu den Diskursen hat: Verknappung diesmal der sprechenden Subjekte“ (26). Foucault nennt sie „die großen Prozeduren der Unterwerfung des Diskurses“ (31); zu ihnen gehören das Ritual, die Diskursgesellschaften, die Doktrinen und die Erziehungssysteme.
Dann stellt er die Frage, wie es kommen konnte, dass die Realität des Diskurses hat „eliminiert“ werden können. Er nennt „(den Gedanken) des begründenden Subjekts“ (32), das Thema der „ursprünglichen Erfahrung“ (33) und das „Thema der universellen Vermittlung“ (ebd.). [55]
Für die Diskursanalyse lassen sich einige „methodische Grundsätze nennen“. Zunächst das „Prinzip der Umkehrung“ (35), das die Formanten der Diskurse eher als Unterdrückungssystem sichtbar machen will denn als positives Produktionssystem. Das Prinzip der Diskontinuität beleuchtet das System der Verhältnisse der Diskurse untereinander. Das Prinzip der Spezifität (36) ist mit dem der Äußerlichkeit zu verbinden: Obwohl die Diskurse vom Empirischen losgelöst in ihrer Eigentümlichkeit gesehen werden sollen, drehen sie sich nicht um einen Kern, den es herauszuschälen gelte.
Diesen Prinzipien oder Regeln werden schließlich, vor einer Zusammenfassung der Diskursanalyse in die zwei sich nicht ausschließenden Grundbegriffe Kritik und Genealogie, vier Begriffsdichotomien zugeordnet, wobei die erste Seite jeweils den neuen Standpunkt bezeichnen soll: Ereignis vs. Schöpfung, Serie vs. Einheit, Regelhaftigkeit vs. Ursprünglichkeit und Möglichkeitsbedingung vs. Bedeutung.
Leider vernimmt man in diesem Kontext, der die Archäologie des Wissens mit einschließt, nichts über den ontologischen Status dieser Regelsysteme, nichts über die Frage, ob es sich um strenge Determinanten handelt, die die Idee der freien und schöpferischen bzw. kritischen individuellen Intelligenz obsolet machen, nichts darüber, ob sie im Gegenteil bloße heuristische Werkzeuge zur Strukturierung historischer Epochen auf diversen Niveaus wären. Handelt es sich vielleicht nur um ein paar experimentell erprobte Grundbegriffe, wie es in der Archäologie des Wissens einmal etwas launig heißt, mitnichten theoretisch abzusichern? [56]
Nur eines ist auch so klar: auf einen Irrationalismus, auf eine gegenaufklärerische und politisch konservative Haltung läuft ein solches Unternehmen nicht hinaus. Und sehr weit von der negativen Dialektik kann es nicht entfernt sein, wenn man bedenkt, gegen was die Diskursanalyse sich vornehmlich wendet, gegen den Hegelianismus, und, das ist mindestens in der politischen Haltung und im Bereich der Rechtssoziologie ein Unterschied zu Habermas, wie ihre Begriffe einen gewissen ständig im Blickfeld haben, Nichtidentität.
Hatte der letzte Abschnitt das gemächliche Abspulen eines historischen Fadens zum Knäuel verknotet – Nietzsche und Foucault wurden nicht mit den notwendigen analytischen Distinktionen vorgetragen – so ist der Faden des historischen Kontinuums der Theorie mit dem Aufriss der aktuellen Diskussion vorläufig unrettbar gerissen. Bevor Adorno in einem verbindlichen Zusammenhang zu Wort kommt, wird es seinem prominentesten Herausforderer geliehen, zuerst als Kritiker, dann als Kritisiertem.
Habermas hat die maßgebliche Adornokritik mehrfach formuliert, zuletzt in der Vorlesungsreihe Der philosophische Diskurs der Moderne. [57] Der Hauptvorwurf, den er in der Vorlesung Die Verschlingung von Mythos und Aufklärung gegen die Dialektik der Aufklärung äußert, lautet, dass Horkheimer und Adorno auf Theorie verzichten und in einer Paradoxie verharren, weil sie zu weit vorgestoßen sind – weil sie die Voraussetzungen der Geltung ihrer Kritik, denen auch sie Folge leisten müssen, selbst schon kritisch angreifen: die herrschende Vernunft. Sie können nicht sagen, wie sie zu ihrer Kritik, die immerhin den Gang der Aufklärung in Frage stellt, gekommen sind. Es ist somit eine bloße Behauptung der Autoren, dass sich, in der Terminologie von Habermas, Macht- und Geltungsansprüche in der gegenwärtigen Vernunft kaum trennen ließen. [58] Zwei Nebensätze scheinen die Habermasische Kritik zu tragen: a) „diese Stimmung, diese Einstellung ist nicht mehr die unsere“ [59] und b) „die Dialektik der Aufklärung wird dem vernünftigen Gehalt der kulturellen Moderne, der in den bürgerlichen Idealen festgehalten (…) worden ist, nicht gerecht. Ich meine die theoretische Eigendynamik, die die Wissenschaften, auch die Selbstreflexion der Wissenschaften, über die Erzeugung technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt (…)“ [60] . Ich nehme kurz zum Vorwurf Stellung, die Dialektik der Aufklärung hätte keine Theorie und könne deswegen auch von gegenaufklärerischen Kräften in Anspruch genommen werden, dann zur Aussage, ein allgemeiner Skeptizismus respektive Pessimismus gegenüber dem Gang der wissenschaftlichen Vernunft sei zumindest heutzutage deplaziert.
Die Habermasische Lektüre der Dialektik der Aufklärung ist das Resultat einer bestimmten Optik, die auf gewisse Momente des Textes nicht mehr achten kann, wenn sie ihren eigenen Konzepten nicht untreu werden will, in diesem Fall denjenigen der Theorie des kommunikativen Handelns. Das entscheidende dieser Konzepte scheint mir darin zu liegen, im Bewusstsein der Einzelmenschen methodologisch zwischen Wahrnehmung und Handlung zu trennen, so dass erstere als bloß privatistische, d. h. noch nicht rationalisierte intersubjektiv irrelevant wird und gesellschaftstheoretisch, wie bei Habermas auffällig, ausgeblendet werden kann. Im Werk Adornos lässt sich aber gerade eine Konstante feststellen, in der Bewusstsein so konzipiert ist, dass es etwas ist, das sich nicht definitiv auf eine eindeutige Struktur reduzieren lässt, weil es, als Ganzes dem Individuum zugehörig, Meinungen folgt, die immer mehr sind als die Summe einzelner Behauptungen (letztlich propositionaler Gehalte, die gänzlich wahr oder falsch sein können bzw. müssen); Meinungen sind Gebilde als begrifflich beschreibbare Modelle. Adorno konzipiert das Bewusstsein wie geschichtliche Gebilde der Theorie oder der Kunst, die destruiert werden können, nicht ohne die Intention, Bewusstsein zu schaffen. [61]
Adornos theoretische Basis, die Habermas vergeblich auszumachen versucht, wäre die Logik des Zerfalls, deren Spuren sich bis in Adornos erste Musiktexte zurückverfolgen lassen; es gehört zu ihrem Kern, den Habermas ignoriert und der hier wie angedeutet erst gestreift werden soll, streng zu unterscheiden zwischen a) der Unwahrheit von Gebilden, die in der kritischen Wahrnehmung, in der „Destruktion“, zum Zeugen von Wahrheit werden (die selbst abwesend ist, weil sie generell außerhalb der Geschichte stehen muss, wenn Theorie als Weltanschauung vermieden werden soll) und b) der Falschheit von Hypothesen, d. h. der begründbaren Falschheit eines propositionalen Gehaltes. Im Sinne eines Konzepts, in nuce einer Theorie, die gesellschaftstheoretisch dasselbe Niveau in Anspruch nimmt wie die spätere Theorie des kommunikativen Handelns, die für die repräsentative Demokratie einsteht, ist die Logik des Zerfalls, die die direkte Demokratie fundiert, schon in den beiden Habilitationsschriften verfolgbar. Sie bildet ein Supplement zur kantisch geprägten Wissenschaftstheorie, der Adorno nie opponierte, und sie bildet ein Gemisch von Kierkegaard und Benjamin, denen sie widerspricht, weil der erstere den Zerfall des Sinnes in der Geschichte ausschließlich theologisch statt erkenntnistheoretisch konzipierte und der zweite, Walter Benjamin, das Verfahren der Erkenntnis des zerfallenen Sinns – die barocke Allegorie – aus der geschichtlichen Gebundenheit herauslöste. Adorno ist als gleichsam fliegender Musikrezensent mit der Tatsache konfrontiert, dass die Formen der klassischen Musik unaufhaltsam zerfallen; erst bei Kierkegaard und – gleichzeitig – bei Benjamin erfährt er die These, dass alle „Sinngebilde“ Sinn nur als zerfallenen gestalten können. Es ist dann nicht mehr weit zur Aussage, es sei der im strengen Sinn methodische Blick der Logik des Zerfalls, der zur Behauptung führt, dass die Vernunft irrational wird, wenn sie die Zwecke als Gebilde der Resultate des Prozesses, der jene erreichen soll, nicht mehr in Frage stellen kann, da die Zwecke eben als historische nichts anderes als soziale Sinngebilde darstellen. Diese Zwecke sind die ökonomischen Akkumulationen, die militärisch-politischen Strategien und die einzelwissenschaftlichen Forschungshypothesen. Irrational werden sie dann, wenn sie sich durchsetzen, aber nicht allgemein diskutiert werden; und diskutiert werden können solche Zwecke von allen denjenigen Einzelmenschen, die Erfahrungen zu sammeln vermochten im kritischen Wahrnehmen von Einzelgebilden überhaupt.
Wenn man die Dialektik der Aufklärung mit den Formulierungen der frühen Werke in Verbindung bringt, sieht man entgegen den Vorwürfen von Habermas a) dass keine Ignoranz der Wissenschaftlichkeit vorliegt, sondern der Umstand beklagt wird, dass Begründungen von Forschungshypothesen keine allgemeine Evidenz aufweisen, sondern sich in einem für die Allgemeinheit undurchsichtigen Kontext, der an sich kein irrationales Gefüge ist, verstecken können, b) dass es Lösungen gibt, den Verblendungszusammenhang zu durchbrechen, weil es immer Individuen sind, die Zwecke in Frage stellen, und c) dass das Werk ungleich der Deutung von Habermas nicht defätistisch ist, sondern umgekehrt geradezu einem Optimismus huldigt, weil es nicht sagt, die Geschichte werde schlimmer – es sagt nur, Versöhnung mit Natur sei dem Geist noch nicht gelungen. [62]
Es sind also nicht Mythos und Aufklärung unaufhebbar in einer irgendwie gearteten Natur verschlungen. Denn was falsch ist, lässt sich benennen: dass den einzelnen die Bedingungen, um sich an der Diskussion über Zwecke, die gesellschaftlich relevant sind, beteiligen zu können, sowohl ontogenetisch wie demokratisch-politisch entzogen werden. Dadurch wird die Zwecke setzende Vernunft, die Vernunft im allgemeinen, irrational. Im gleichen Zug ist es möglich anzugeben, wie diese allgemeine Irrationalität zu überwinden ist: durch Förderung der gesellschaftlichen institutionellen und der persönlichen individuellen Bedingungen der Kritik von festgelegten und festzulegenden Zwecksetzungen.
Was Habermas unsere veränderte „Stimmung“ nennt, scheint nun nichts anderem gleichzukommen als einer Überreizung des Optimismus im Umfeld der Dialektik der Aufklärung, durch falsche Übersetzung aus der Sprache der Bewusstseinsphilosophie: Die Transformation der Kritik in den Diskurs macht aus der Darstellung einer Möglichkeit die Repräsentation einer bereits erfüllten Wirklichkeit. Natürlich gibt es heutzutage zu allen Fragen Wissenschaftskongresse, an denen über Sinn und Zweck von Hypothesen diskutiert wird; allerdings hätte eine darauf ausgerichtete Soziologie hinter die Frage der Stabilität nicht nur der finanziellen Bedingungen dieser Kongresse mehr als bloß ein Fragezeichen zu setzen.
1.5.2 Partiell metaphysische Gesellschaftstheorie
Die Habermasische Arbeit wird durch ein besonderes und besonders ehrgeiziges Motiv in Schuss gehalten: es soll die Theorie nicht nur jeden Irrationalismus von sich fernhalten, sondern – Kantisch – mit Bedacht ihre Anschlussfähigkeit an die Wissenschaften im Griff behalten. Vor allem die Aufsatz- und Vortragssammlung Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus [63] ist ein beeindruckendes Zeugnis von seinen unermüdlichen Auseinandersetzungen mit den Wissenschaften der Psychologie (Piaget und Kohlberg), der Soziologie (Parsons und Luhmann), der Geschichte und Ethnologie (Eder und Godelier) sowie der Sprach- und Handlungstheorie (Mead und an Stelle Austins Lorenzen). Der Sinn dieser Wissenschaftlichkeit ist keineswegs Szientismus und Abwehr von (politischer) Praxis; er liegt nach wie vor in der Marxschen Programmatik, die als falsch erkannte Wirklichkeit durch Kritik zu verändern. In diesem Licht drängt bei Habermas alles auf eine „nachmetaphysische“ Befindlichkeit.
Bekanntlich war für die Theorie seit je die Freiheit, die Denkens- und die Handlungsfreiheit, eines der gewichtigsten Probleme, wenn nicht überhaupt das gewichtigste Problem – die Freiheit war es, die das Wissen zum Glauben verführte, die Praxis zum Dogmatismus. Wie löst die Diskurstheorie diese Frage? Was ist Freiheit und Autonomie im Rahmen der kommunikativen Vernunft? Was ist die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände der Erkenntnis in der Theorie von Habermas? „(Autonomie) meint nicht mehr Selbstgesetzgebung wie bei Kant, Selbstverwirklichung im Sinne Hegels oder Marx' (…), sondern die kognitive Kompetenz zur Übernahme eines universalistischen Standpunktes sowie die interaktive Kompetenz, auf dieser Grundlage zu handeln.“ [64] Dieser Kern der kommunikativen Vernunft, als die Form der Autonomie, ist nun nicht mehr wie einleitend gezeigt bei Kant, Hegel und Marx als Prämisse oder Perspektive gefasst, sondern in den empirischen Wissenschaften breit abgestützt. Die Basis der Kritik, die sich in der Theorie der kommunikativen Vernunft äußert, ist gleichermaßen in der geschichtlich-sozialen wie in der ontogenetisch-individuellen Wirklichkeit immer schon angelegt. Habermas definiert sein „Projekt“, in Abwehr ideologischer Implikationen, als „die Rekonstruktion einer Stimme der Vernunft, die sprechen zu lassen wir in der kommunikativen Alltagspraxis nicht umhin können, ob wir es wollen oder nicht“ [65] . Habermas ist dadurch in der unkomfortablen Lage, dass er einerseits nicht müde werden darf, darauf hinzuweisen, dass kommunikative Vernunft immer schon da ist, dass er andererseits nicht darum hin kommt zuzugeben, dass die sozialen Bedingungen keineswegs optimal sind, damit sich das kommunikativ-kritische Potential gesellschaftlich und individuell realisieren könnte. Es ist eines, „den Eigensinn der theoretisch-instrumentellen, der moralisch-praktischen und der ästhetisch-expressiven Rationalität (herauszustellen)“, ein anderes aber, „ihren Zusammenhang im verständigungsorientierten Handeln deutlich (zu machen)“ [66] .
Der irritierende Optimismus, der im jüngsten Werk durch konservative Appelle im engen Sinn neue Blüten treibt – dem Recht, das die kommerziellen und militärischen Gesellschaften a priori schützt, soll aus dem einen Grund Vertrauen entgegengebracht werden, weil auch es sich legitimieren muss – rührt von der Ausklammerung historischer Perspektiven in den Pfeilern der Gesellschaftstheorie; dadurch wird die Position, die die Kritik in der „Bewusstseinsphilosophie“ einnahm, durch die der neutralen kommunikativen Kompetenz besetzt, die offensichtlich Mühe bereitet, wechselseitige Verständigung und Einverständnis auseinander zu halten. [67] Zwar steht die diskursive, argumentierende Vernunft im Zentrum – doch verloren scheint die Einsicht, dass ihre Begrifflichkeit sozialen und historischen Bedingungen folgt. Denn die Realisierung von Rationalität setzt nur wechselseitige Aktoren voraus –Intersubjektivität – keine geschichtlich geronnenen gesellschaftlichen Sedimentierungen. Erstrebt eine gewisse Behauptung einen Wahrheitsgehalt, so ist dieser auch herauslösbar, wie immer die Situation vernetzt sein mag, in der jene geäußert wird. Die Diskursformationen und die Perspektiven der Wahrheit werden zu dem einen, technizistisch offenlegbaren Diskurs, dessen Regeln alles konstituieren, was in der Ordnung des Systems und/oder der Lebenswelt Bedeutung anzunehmen imstande ist. Als Regelsystem ist die kommunikative Vernunft eine Moraltheorie; deren Sinn macht es aus, vernünftige politische Diskursinhalte und Diskursformen begründen zu können, indem sie aus einem einheitlichen theoretischen Gefüge ableitbar sind, der Diskursethik. [68] Politische Meinungen, und zetteln sie einen Krieg wie den letzten im Golf an, haben in sich schon die angemessene rationale, keineswegs durch Herrschaft deformierte Form, die von ihnen sagen lässt, ob sie richtig, gültig und wahr sind – sofern sie sich nur, ganz im Gegensatz zur schlechten Manier der Sprachlosen, auf bestehende Verhältnisse zu beziehen bescheiden. – Es fällt auf, dass die theoretische Einheitlichkeit dazu verführen muss, die direkte Demokratie als irrational einzustufen oder als eine für die moderne Theorie uninteressante Form der Macht- und Verwaltungskoordinierung, da in ihr die Sachentscheidungen durch Mehrheitsbeschluss und mehr oder weniger realisierte Minderheitenberücksichtigung nicht in einem enganliegenden Prozess von argumentierenden Äußerungen begleitet sind: in der direkten Demokratie kann die Stimme zu Sachfragen auch von kommunikativ gänzlich Inkompetenten abgegeben, der Stimmakt selbst in unzurechnungsfähigem Zustand durchgeführt werden. [69]
In der Einleitung der Theorie des kommunikativen Handelns macht der Abschnitt über fremde Kulturen den Zusammenhang von Ethnozentrismus und Metaphysik deutlich; trotz Habermas' vorbildlichem Nachvollzug der ethnologischen Relativismusdebatte lässt sich gerade hier begreifen, wie der Primat des eindeutigen propositionalen Gehaltes, auf den sich alles Rationale beziehen soll, mit dem offen Metaphysischen dieser Passage korrespondiert.
Habermas' Metaphysik entsteht durch die Parallelisierung von ontogenetischen Lernprozessen, wie sie Piaget beschrieb, mit geschichtlich-phylogenetischen. „Die universalistische Position zwingt zu der mindestens im Ansatz evolutionstheoretischen Annahme, dass sich die Rationalisierung von Weltbildern über Lernprozesse vollzieht.“ [70] Diese richten sich nicht nach inhaltlichen Fragen aus, sondern folgen formalen Reflexionsstufen, die sich von überlebten Konkretismen lösen. Ist auf der untersten Stufe außen und innen, Objektivität und Subjektivität, Natur und Kultur vermischt, so ermöglicht die stetige Formalisierung der Vernunft zum einen die Unterscheidung dieser Bereiche, zum anderen die konzeptuelle Unterwerfung „tieferer“ Stufen. Geschichtlich spätere Denk- und Ausdrucksmodalitäten sind nicht nur anders, sondern auch besser, mit einem substantiell tieferen Erfahrungsschatz.
„(Ich werde) mich stillschweigend eines Lernkonzepts bedienen, das Piaget für die Ontogenese von Bewusstseinsstrukturen entwickelt hat. Piaget unterscheidet bekanntlich Stufen der kognitiven Entwicklung, die nicht durch neue Inhalte, sondern durch strukturell beschriebene Niveaus des Lernvermögens gekennzeichnet sind. Um etwas Ähnliches könnte es sich auch im Falle der Emergenz neuer Weltbildstrukturen handeln. Die Zäsuren zwischen der mythischen, der religiös-metaphysischen und der modernen Denkweise sind durch Veränderungen im System der Grundbegriffe charakterisiert. Die Interpretationen einer überwundenen Stufe, gleichviel wie sie inhaltlich aussehen, werden mit dem Übergang zur nächsten kategorial entwertet. Nicht dieser oder jener Grund überzeugt nicht mehr, die Art der Gründe ist es, die nicht mehr überzeugt.“
Wie schnell ist man nur bei der unheimlichen Phrase: Es ist die Art der Fremden, die sie uns fremd macht; gegen die einzelnen wäre man durchaus freundlich eingestellt… Umgekehrt kann eine solche Art von Gründen auch in bloß vereinzelten „Denkfiguren“ ruhen; Habermas nimmt es hier etwas locker, um das Schematische im Modell der Stufenabfolge desto unumstößlicher festzuschreiben.
„Eine Entwertung von Erklärungs- und Rechtfertigungspotentialen ganzer Überlieferungen ist in den Hochkulturen bei der Ablösung mythisch-narrativer, in der Neuzeit bei der Ablösung religiöser, kosmologischer oder metaphysischer Denkfiguren eingetreten. Diese Entwertungsschübe scheinen mit Übergängen zu neuen Lernniveaus zusammenzuhängen; damit verändern sich die Bedingungen des Lernens in den Dimensionen sowohl des objektivierenden Denkens wie der moralisch-praktischen Einsicht und der ästhetisch-praktischen Ausdrucksfähigkeit.“ [71]
Es geht keineswegs darum, die Debatte um Relativismus und Universalismus neu anzuzetteln: es scheinen mir Habermas' Universalismusansprüche an die Vernunft selbstverständlich, und es ist unübersehbar, dass im Ganzen aus der Theorie der kommunikativen Vernunft keine kulturspezifischen, eurozentrischen Ansprüche und Überlegenheiten ableitbar sind. Dennoch ist in dieser Theorie keine Anlage bereitgestellt, wie interkulturelle Kontakte geschehen könnten, ohne dass die überlegene, organisierende Position schon im voraus feststehen müsste, und folgende Passage kann nicht verbergen, dass andere Kulturen a priori für die Verhaltensregelungen keinen Beitrag leisten können:
“(Es) wird deutlich, welche formalen Eigenschaften kulturelle Überlieferungen aufweisen müssen, wenn in einer entsprechend interpretierten Lebenswelt rationale Handlungsorientierungen möglich sein, wenn sie sich gar zu einer rationalen Lebensführung verdichten können sollen:
a) Die kulturelle Überlieferung muss formale Konzepte für die objektive, die soziale und die subjektive Welt bereitstellen, sie muss differenzierte Geltungsansprüche (propositionale Wahrheit, normative Richtigkeit, subjektive Wahrhaftigkeit) zulassen und zu einer entsprechenden Differenzierung von Grundeinstellungen (objektivierend, normenkonform und expressiv) anregen. Dann können symbolische Äußerungen auf einem formalen Niveau erzeugt werden, auf dem sie systematisch mit Gründen verknüpft werden und einer objektiven Beurteilung zugänglich sind.
b) Die Kulturelle Überlieferung muss ein reflexives Verhältnis zu sich selbst gestatten; sie muss ihrer Dogmatik soweit entkleidet sein, dass die durch Tradition gespeisten Interpretationen grundsätzlich in Frage gestellt und einer kritischen Revision unterzogen werden dürfen. Dann können interne Sinnzusammenhänge systematisch bearbeitet und alternative Deutungen methodisch untersucht werden. Es entstehen kognitive Aktivitäten zweiter Ordnung: hypothesengesteuerte und argumentativ gefilterte Lernprozesse in Bereichen des objektivierenden Denkens, der moralisch-praktischen Einsicht und der ästhetischen Wahrnehmung.“
„Hypothesengesteuerte und argumentativ gefilterte Lernprozesse in Bereichen des objektivierenden Denkens“ – das heißt, was der Imperialismus immer schon behauptete: andere Nahrungsmittelproduktionen als die der Coca-Cola Gesellschaften sind falsch. Weiter:
“c) Die kulturelle Überlieferung muss sich in ihren kognitiven und evaluativen Bestandteilen soweit mit spezialisierten Argumentationen rückkoppeln lassen, dass die entsprechenden Lernprozesse gesellschaftlich institutionalisiert werden können. Auf diesem Wege können kulturelle Subsysteme für Wissenschaft, Moral und Recht, für Musik, Kunst und Literatur entstehen, in denen sich argumentativ gestützte, durch Dauerkritik verflüssigte, aber zugleich professionell abgesicherte Traditionen bilden.“
Aus diesen Zeilen höre ich ein kategorisches Desinteresse an den Formen der Moral, der Musik und der Kunst anderer Kulturen heraus. An solchen Stellen erklärt die Theorie zuviel; sie ist metaphysisch überspannt.
„d) Die kulturelle Überlieferung muss schließlich die Lebenswelt in der Weise interpretieren, dass erfolgsorientiertes Handeln von den Imperativen einer immer wieder kommunikativ zu erneuernden Verständigung freigesetzt und von verständigungsorientiertem Handeln wenigstens partiell entkoppelt werden kann. Dadurch wird eine gesellschaftliche Institutionalisierung zweckrationalen Handelns für generalisierte Zwecke, z B. eine über Geld und Macht gesteuerte Subsystembildung für rationales Wirtschaften und rationale Verwaltung möglich.“ [72]
Es ist deutlich: Rekonstruierbare Entwicklungsmuster aus der abendländischen Geschichte werden normativ verallgemeinert; dies ist nicht der Universalismus der Vernunft, sondern der des überalterten Euroamerikazentrismus. Neben dem ontogenetischen kann auch das phylogenetische Entwicklungsmodell nachvollzogen werden, wenn auch die empirische Basis für das zweite nicht dieselbe Sicherheit gewährt. Falsch aber ist der Schluss, dass die einmal erreichten Stufen unabhängig von materiellen Faktoren sich etablieren und reproduzieren könnten, denn es ist nicht voraussehbar, ob in Euroamerika diese gesellschaftlich-materiellen Formen nicht zerfallen würden, und es ist von daher nicht beurteilbar, ob sie über den Weg politisch-ökonomisch-kultureller Verhandlungen anderen Kulturen bzw. anderen Gesellschaften normativ kontrastiert werden sollen – und auch, ob nicht aus unterschiedlichst akkulturierten Gesellschaftstypen andere, nur sporadisch formalisierte Vernunft- und Handlungstypen hervorgehen könnten.
Die falsche Metaphysik – Affirmation gegenüber der abendländischen Entwicklungslogik, die die Bildungsgüter mit einschließt – ist bei Habermas ermöglicht durch die Trennung von Erkenntnis und Darstellung sowie die Ausklammerung historischer Materialität im Regelsystem der Prozeduralität kommunikativer Vernunft; dadurch steht in der Theorie wieder die absolute Erkenntnis im Zentrum, anstatt das, was dem Interesse der Freiheit dienen könnte.
Demgegenüber sind die „Gebilde“ Adornos, deren Konzipierung jetzt gefolgt werden soll, nicht metaphysisch, denn sie sind nie ganz wahr; aber ebensowenig sind sie weder in sich irrational, noch irrational produziert oder irrational zu deuten, und Habermasens Trennung von Erkenntnis und Darstellung hat ja das Motiv, das Rationale vom Irrationalen besser unterscheiden zu können, um besser als Horkheimer und Adorno sagen zu können, was heute am System irrational sei und was es sei, das die kommunikative Vernunft in der Lebenswelt unterdrücke – und es gelingt ihm dies paradoxerweise desto besser, rationaler und wissenschaftlicher, je zuversichtlicher er von der kommunikativen Vernunft selbst spricht. Adornos Erkenntnisgegenstand, die Gebilde, sind das Mittel, das, wenn ihm Aufmerksamkeit zukommt, Veränderung nach sich zieht: Veränderung durch Verbesserung des Gebildes, durch Erneuerung der Produktionsbedingung und durch Erneuerung der Produktions- und Rezeptions- bzw. Konsumtionsverhältnisse. Bei Habermas scheint Veränderung sekundär, akademische Erkenntnis, die das falsche Irrationale stehen lässt, primär. Diese Haltung kann theoretisch nicht widerspruchsfrei kritisiert werden; das wird erst dann möglich, wenn der Aspekt der Darstellung in den Erkenntnisgegenständen wieder berücksichtigt wird. Dann wird sich zeigen, dass man Habermas konservativ und romantisch (eurozentristisch) deuten kann, auch wenn auf der argumentativen Ebene die Texte in allen Registern dagegensprechen wollen. [73]
[1] Waffenplätze und Glaspaläste des Finanzkapitals sind keine analytischen Kategorien, die eine Totalisierung zuließen; sie sind bloße auffällige Merkmale, die für Ratlosigkeit, nicht für Erkenntnis einstehen. Was sowohl das eine wie das andere betrifft, sind keine homogenen Interessenlager auszumachen. In der analytischen Bezugnahme auf die Warenform bzw. das Wertgesetz – das ist mit Adornos strukturell Wesentlichen der Gesellschaft gemeint – war eben dies noch der Fall und zumindest bis vor die Niederschrift der Dialektik der Aufklärung als politische Möglichkeit auch reklamiert. Die Rede von einer „Menschheit, die sich selber zum Ding, zum Objekt ihrer eigenen Organisation macht“ aus dem zweiten Teil der Philosophie der neuen Musik (12; 177), verleugnet bereits die Möglichkeit selbstbestimmter Politik verwaltungsunabhängiger, souveräner „Gruppen“.
[2] Vgl. Ton, Wort, Synthese, Boulez (1972), 114 (wird unten, Kapitel 3, zitiert).
[3] Luhmanns Platonismus enthält das Bestreben, alles, was wirklich ist, zwar als komplex zu begreifen, aber zugleich als ausnahmslos systemfunktional.
[4] Flasch (1986).
[5] Das ist keine Anspielung auf Whiteheads Philosophieverständnis als einer geschlossenen Variation platonistischer Fragen, sondern eine erste Vorbereitung für die Aufmerksamkeit gegenüber dem Mangel bei Habermas, in der Betonung und engen Fixierung des Wertes des propositionalen Gehalts metaphysisch in Exklusivität zu verharren, in der Betonung der Prozeduralität des argumentativen Diskursverlaufs andererseits relativistisch ins Unverbindliche abzuschweifen, demgegenüber systemfunktionales Vertrauen entgegenzubringen offenbar geboten erscheint.
[6] Dies ist eine Problematik, in der sich die Bewusstseinsphilosophie von Kant bis Husserl nie definitiv hat entscheiden können; sie führte maßgeblich zum linguistic turn und mit diesem aus der Bewusstseinsphilosophie hinaus.
[7] Descartes (1960), Vierter Teil, Fundamente der Metaphysik.
[8] Der Gegenstand des Erkennens bleibt bis (und mit) Kant – mit der zwitterhaften Ausnahme von Leibniz – ein toter, und bis zu Kant bleibt das Subjekt der Erkenntnis, soweit es moralisch tätig ist, einer weiteren Instanz unterworfen – dem rationalen Gott bei Descartes, der Pflicht, dem selbstbestimmten Gesetz oder dem Überich bei Kant – selbst bis zu Husserl (eine philologische Angabe zu diesem bei Derrida, 1987, 59f).
[9] Er selbst wurde als Ungläubiger betrachtet, von den Gassenkindern auch „Gläubenix“ gerufen.
[10] Leibniz (1966), 427f.
[11] Als ausführliches Analysebeispiel sei erwähnt Die Ordnung der Geschlechter, wo der Umschlag dargestellt wird von einem einigermaßen freundlichen Bild der Frau bei Rousseau zur abstrusen Verleugnung der Frau durch den Rekurs auf die sozial zur Dominanz stilisierten falschen exakten Wissenschaften, Honegger (1991).
[12] Leibniz (1966), 269.
[13] Sutter (1988), 86. Hier auch Näheres zu Bayle und dessen unermüdlichen Leibnizkritik.
[14] Der Gesetzesbereich der Zweckursachen enthält in nuce die Diskussion über Zwecke, die von der positivistischen Vernunft unterschlagen wird. Leibniz thematisiert aber zentral nur die moralischen Zwecke, die er, insbesondere in der Theodizee, mit dem logisch-metaphysischen Optimum kurzschließt.
[15] Vgl. dazu Lovejoy (1985). Das Buch bietet eine sehr gute Darstellung der Neuzeit.
[16] Leibniz (1966), 424f.
[17] Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch: Eine Aussage und ihre Negation können zusammen nicht wahr sein. Der Satz vom zureichenden Grund: Alles was ist und was behauptet wird, hat einen zureichenden Grund dafür, dass es so ist, auch wenn die Gründe nicht zu erkennen sind (Monadologie ¦ 31f). Dazu Heidegger (1978), 154: „Es ist charakteristisch für die mathematische Denkweise, dass Leibniz für seinen Zweck Wahrheit als identitas definiert, ohne gerade hier nach der possibilitas dieser identitas zu fragen.“
[18] Leibniz (1966), 428.
[19] Vgl. G. W. Leibniz (1948).
[20] John Toland, Brief V: Bewegung als eine wesentliche Eigenschaft der Materie – Als Antwort auf einige Bemerkungen eines vornehmen Freundes zu meiner Widerlegung Spinozas, in: Toland (1959), 120.
[21] Der drohende Fatalismus entfällt bei Leibniz, weil die Vernunft die Steuerung zu durchschauen vermag, gerade nicht ihr Opfer ist.
[22] Leibniz (1966), 429f (Hervorhebung U. R.).
[23] Entzieht man dem Transzendenzplan das planende Subjekt, so hat man es mit einem Immanenzplan zu tun, der sowohl in einer idealistischen Fassung denkbar ist, wie bei Spinoza, als auch in einer materialistischen, vielleicht wie bei Toland. – Vgl. zu diesem Begriffspaar Deleuze/Parnet (1980), 99ff.
[24] Ca. 1690; Leibniz (1948), 885.
[25] Wenn hier pauschalisierend gesagt wird, die philosophische Vernunft würde immer nur imstande sein, einen dogmatischen Ausgangspunkt anzugeben, solange sie ihn positiv beschreibt – muss man dann einem Irrationalismus nachgeben? Nicht im geringsten, weil die philosophische Vernunft nicht mit dem Begriff des rationalen Verhaltens und der rationalen Argumentation gleichgesetzt werden muss. Aber der Ausgangspunkt kann kein einfacher sein, kann keiner sein, der nicht schon eine gewisse Komplexität aufweisen würde. Wenn er nicht gelehrt werden kann, heißt dies nicht, dass er sich nicht durch Anstrengung aneignen ließe. Er besteht dann in der Negativität des vorgegebenen Ganzen. Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes, nach einem Ausgangspunkt ausschauzuhalten, der einem ein Recht auf Einsicht in die Vernünftigkeit der Vernunft gewähren würde. Gewiss ist nur, dass aus dem moralisch Guten ein Schlechtes hervorgeht, wenn in der Anstrengung nachgelassen wird; die Anstrengung ist nicht individuell und privat, sondern substantiell und allgemein – sie ist immer gesellschaftlich, auch wenn sie als das Negative im wesentlichen Gesellschaftliches erkennt.
[26] Vgl. Jacques Derrida, Cogito und Geschichte des Wahnsinns, in: Derrida (1976), vor allem p. 89. Michel Foucault sagt in seinem Buch Wahnsinn und Gesellschaft – Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, im Mittelalter sei der Wahnsinn akzeptiert gewesen; das zeigt sich in den scholastischen Systemen so, dass die Vernunft sich nicht abschließend rechtfertigen kann: die philosophisch-logische Begriffsanalyse steht im Dienste des Glaubens und der Kirche. Eine Rechtfertigung der Vernunft geschieht erst im Cogito bei Descartes. Von hier an wird der Wahnsinn zum Schweigen gebracht, und es beginnen die disziplinierenden Gesellschaftsmechanismen der Ausgrenzung und der institutionellen Einschließungen. Derrida widerspricht dieser Descartes-Deutung. Denn der methodische Zweifel ist an die sprachliche Entäußerungsform gebunden. Und die Aussage „Ich denke also bin ich“ ist keine, die nicht auch von einem Wahnsinnigen gemacht werden könnte. Folglich ist der Rationalismus, der im Cogito seinen Grund hat, nicht befähigt – er ist nicht fähig und er hat keine Kompetenz dazu – etwas über die Vernünftigkeit der Vernunft auszusagen; er vermag nichts über ihr Verhältnis zum Wahnsinn auszusagen und nichts über den Wahnsinn in der Geschichte als die Geschichte der Vernunft selbst.
[27] In einer gutwilligen Darstellung lässt sich sagen, dass Hume die Theoriegeleitetheit von Gesetzesüberprüfungen, wie sie im modernen kritischen Rationalismus im Zentrum steht, vorweggenommen hat, wenn er auch das Entscheidende nicht zu leisten vermochte, die Ausarbeitung eines theoretischen Argumentationszusammenhanges, wie ihn Poppers Logik der Forschung vorschlägt und in dem jene Vorausahnung ein Moment, ein Theorem gewesen wäre.
[28] „Diesem Dienste der Kritik den positiven Nutzen abzusprechen, wäre eben so viel, als sagen, dass Polizei keinen positiven Nutzen schaffe, weil ihr Hauptgeschäfte doch nur ist, der Gewalttätigkeit, welche Bürger von Bürgern zu besorgen haben, einen Riegel vorzuschieben, damit ein jeder seine Angelegenheit ruhig und sicher treiben könne.“ (Kant, 1974, 30, B XXV)
[29] Es sind zwei verschiedene Fragen, ob Kant nur schwierige Erkenntnismöglichkeiten beschreibt oder empirisch gehaltvolle Wissenschaften: dass die Wissenschaften im 19. Jahrhundert sich in ihrem Gehalt beschleunigend ausbreiteten, war keineswegs Kants Prognose.
[30] „Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung.“ (Ebd., p. 201, A 158, B 197)
[31] Kant (1916), 448 (Ý 36).
[32] Kant (1974), 136, B 131f (Ý 16). – In der ersten Auflage wird weniger die Einheit und der Bezug des Bewusstseins auf das reale Phänomen betont als die Fähigkeit, die Virtuosität der Apperzeption, d. h. des Bewusstseins, zur „Rekognition“ (A 103ff), also das aktivische Moment im Erkenntnisprozess.
[33] Ebd., B 133.
[34] Das Faktum des Formellen des Kategorischen Imperativs, dass so gehandelt werden soll, dass jede Handlung verallgemeinerbar wäre, wird von Kant als zugleich frei bestimmt und kausal wirkend begriffen.
[35] Kant (1968), 180f, A 110f.
[36] Ich glaube nicht, dass diese kritische Verwendung der Ausdrücke Idealismus bzw. Platonismus „einer der zu weiten Konfektionsanzüge (ist), in denen man die (missliebigen; U. R.) Philosophen (…) schlottern lässt“ (Derrida, 1993, 99). Es gibt bei Kant materialistische Momente – die obsoleten erweisen sich aber durchwegs als dem Idealismus zuschreibbar.
[37] Kant (1974), A 80, B 106.
[38] Das Systematische in der Systemphilosophie ist nicht ihren Teilen äußerlich, so dass sie im Detail ersetzbar wären; es verunstaltet diese a priori. Weder ist ein Kantianismus mit Soziologie möglich, noch ein Hegelianismus ohne affirmative Totalität: Im Entstehen des Argumentationsgeflechtes der Systemphilosophie im deutschen Idealismus nimmt alle bisherige Philosophie den Charakter der Systemphilosophie an…
[39] Hegel (1970), 82 (in den Hegelzitaten alle Hervorhebungen vom Autor).
[40] Weil das Anerkennen nicht gelingt – durch bloßes Akzeptieren wäre die Dialektik abgebrochen, gebrochen, was Hegel mit dem despektierlich verwendeten Begriff der Person nicht gänzlich ignoriert (149) – zeigen sich die zwei Momente der Entzweiung als Selbständiges und Unselbständiges. Von hier an lässt sich die Bewegung nicht weiterentwickeln, wenn die Momente nicht als wirkliche und vereinzelbare Realien beschrieben werden. Das heißt, die Anerkennung des Ich geschieht bis zu einem gewissen Grade im vereinzelten Ich – als vollendete bedarf sie der empirischen Wirklichkeit anderer Menschen. So gesehen, stellt Hegel Kants apriorische Einheit der Apperzeption nicht radikal in Frage, wenn auch tendenziell so stark wie möglich. – Der Personbegriff hat bei Marx wieder eine schillernde Funktion, indem ihm derjenige der ökonomischen Charaktermaske gegenübersteht (Marx, 1975, 100), eine nur zu leicht als Spießbürger zu kritisierende bei Kierkegaard.
[41] Dass knechtische Bewusstseine Herren benötigen, kann ich, wenn auch mit Nervosität, verstehen; dass aber lustige Mägde und auch selbständige Fräuleins affenstarke Herren bevorzugen, scheint mir eines der Rätsel zu bleiben, denen die Sozialwissenschaften tunlichst aus dem Wege gingen, und mit der Frauenforschung wird sich das – aber ich täusche mich diesbezüglich gerne – kaum bessern.
[42] Vgl. Habermas (1985), 67: „Wir verharren bis heute in der Bewusstseinslage, die die Junghegelianer, indem sie sich von Hegel und der Philosophie überhaupt distanzierten, herbeigeführt haben. Seit damals sind auch jene auftrumpfenden Gesten wechselseitiger Überbietung in Umlauf, mit denen wir uns gerne über die Tatsache hinwegsetzen, dass wir Zeitgenossen der Junghegelianer geblieben sind. Hegel hat den Diskurs der Moderne eröffnet; erst die Junghegelianer haben ihn dauerhaft etabliert.“ (Hervorhebung vom Autor.)
[43] Marx (1968), 111ff (in den Marxzitaten alle Hervorhebungen vom Autor).
[44] Die Übernahme von Formulierungen geht sehr weit, teilweise ohne Distanzierung ihrer Komplikationen: „Der Nicht-Arbeiter tut alles gegen den Arbeiter, was der Arbeiter gegen sich selbst tut, aber er tut nicht gegen sich selbst, was er gegen den Arbeiter tut.“ (63) Die idealisierenden und verklärenden Voraussetzungen der Dialektik der Anerkennung sind im vorangehenden Abschnitt zu kritisieren versucht worden. Die hegelianischen Anleihen bewirken nicht nur ein unilineares Geschichtsmodell, sondern erschweren insbesondere eine realistische Perspektive gegenüber der Arbeitsteilung, indem sie die Möglichkeit ihrer romantischen, d. h. totalen Aufhebung suggerieren.
[45] Marx (1975), 86, 89.
[46] Marx (1968), 59.
[47] Marx/Engels (1969), 17.
[48] Marx (1974), 15.
[49] Vgl. auch p. 26f: „Wie überhaupt bei jeder historischen, sozialen Wissenschaft, ist bei dem Gang der ökonomischen Kategorien immer festzuhalten, dass, wie in der Wirklichkeit, so im Kopf, das Subjekt, hier die moderne bürgerliche Gesellschaft, gegeben ist, und dass die Kategorien daher Daseinsformen, Existenzbestimmungen, oft nur einzelne Seiten dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts ausdrücken, und dass sie daher auch wissenschaftlich keineswegs da erst anfängt, wo nun von ihr als solcher die Rede ist.“
[50] Ich meine die Trennung dieser zwei Nietzsches hier vornehmen zu müssen, weil insbesondere bei Habermas keine Spuren des „methodologischen“ sichtbar sind; alle Nietzsche betreffenden Aussagen haben die Tendenz einer sozialpsychologischen Lokalisierung, weil Habermas sein Programm einem für ihn in der Theorie ubiquitär herrschenden Neo- und Jungkonservativismus entgegenstemmen will. Einige Formulierungen aus Der philosophische Diskurs der Moderne, Habermas (1985): „Im Diskurs der Moderne erheben die Ankläger einen Vorwurf, der sich in der Substanz von Hegel und Marx bis Nietzsche und Heidegger, von Bataille und Lacan bis Foucault und Derrida nicht verändert hat. Die Anklage ist gegen eine im Prinzip der Subjektivität gründende Vernunft gerichtet (…).“ (70) „Nietzsche will den Rahmen des okzidentalen Rationalismus, in dem sich die Kontrahenten des linken wie des rechten Hegelianismus immer noch bewegen, sprengen. Dieser Antihumanismus, der von Heidegger und Bataille in zwei Varianten fortgesetzt wird, ist für den Diskurs der Moderne die eigentliche Herausforderung.“ (93) „(Nietzsche hat) nur die Wahl, entweder die subjektzentrierte Vernunft noch einmal einer immanenten Kritik zu unterziehen – oder aber das Programm ganz aufzugeben. Nietzsche entscheidet sich für die zweite Alternative – er verzichtet auf eine erneute Revision des Vernunftbegriffs und verabschiedet die Dialektik der Aufklärung.“ (106f; Hervorhebung vom Autor.) – Auch das Nachwort zur Sonderausgabe der erkenntnistheoretischen Schriften Nietzsches von 1968 favorisiert denjenigen der Grundlegung aller Erkenntnis in der Moral, also im Willen zur Macht – es richtet sich ausschließlich nach dem ersten Nietzsche aus. Der methodologische wird füglich entstellt: Nietzsche wird „eine Art negative Dialektik“ nachgesagt, als „ein alternativer Weg zur Mystik“ (Habermas, 1982, 518 oder Habermas, 1973, 252). Im ebenfalls 1968 erschienenen vorkommunikationstheoretischen Hauptwerk Erkenntnis und Interesse wird Nietzsche ähnlich gelesen und als Vorläufer der Psychoanalyse gedeutet (Habermas, 1975, 353ff).
[51] Foucault (1974a), 7. Ich verzichte darauf, die Ergänzungen zu diesem Text, der Antrittsvorlesung, zu diskutieren, wie sie im kurz davor geschriebenen Werk Archäologie des Wissens festgehalten sind.
[52] Die Anführungszeichen haben einen strengen Sinn: Foucault spielte zeitweise mit dem Begriff des Positivismus, und gegen den des Strukturalismus hat er sich nach Die Ordnung der Dinge konstant gewendet – wie die Lehrbücher zeigen erfolglos. Eine adäquate und zugleich plakative Einordnung seines methodischen Denkens hat sich nicht ergeben, nicht ergeben können, weil, wie ich meine, es zu stark von seinem Denkstil und seiner Rhetorik abhängt. Das heißt nicht, dass nicht einzelne methodologische Momente verallgemeinerbar wären; doch scheinen sie mir mehr Denkanregungen gleichzukommen als einem verbindlichen methodologischen Regelsystem entsprechen zu können. – Zum näheren Verhältnis Foucaults zu Nietzsche vgl. Marti (1988), 69ff und Foucault (1974b).
[53] So Claudia Honegger, zitiert in Marti (1988), 104f: „Le pouvoir – dieses schummrige Amalgam aus Macht, Herrschaft, struktureller Gewalt, Autorität, Prestige, Charisma – wird nie `lokalisiert', sondern zu einem Moloch hochstilisiert, der überall gleichermaßen lauert und so stets die Analyse konkreter Herrschaftsverhältnisse konterkariert.“ Ob ein Mensch schon konkrete Herrschaftsverhältnisse befriedigend hat analysieren können, ist allerdings eine Frage, ob der sich die Soziologie in auffälliges Schweigen hüllt.
[54] Foucault (1974a), 7f.
[55] Man muss der Versuchung widerstehen, diese Komplexe kommentieren und zum Beispiel auf die Akzentuierungen in den vorliegenden vorangegangenen Seiten beziehen zu wollen, auch wenn diese einfacher als die Foucaultschen erscheinen. Gerade unvermittelt erhalten sie eine Frische, die eine produktive Vermittlung im weiteren ermöglicht.
[56] Foucault (1973), 58f: „…~ Das ist das Feld, das wir jetzt durchlaufen müssen; das sind die Begriffe, die man ausprobieren muss, und die Analysen, die man vornehmen muss. Ich weiß, dass die Risiken nicht klein sind. Ich habe mich bei einer ersten Suche bestimmter Gruppierungen bedient, die ziemlich matt, jedoch reichlich vertraut sind: Nichts beweist mir, dass ich sie am Ende der Analyse wiederfinden werde, noch dass ich das Prinzip ihrer Abgrenzung und Individualisierung finden werde. Ich bin nicht sicher, dass die diskursiven Formationen, die ich isolieren werde, die Medizin in ihrer globalen Einheit, die Ökonomie und die Grammatik in der Gesamtkurve ihrer historischen Bestimmung definieren werden. Ich bin nicht sicher, dass … „ Die erkenntnistheoretische Zurückhaltung ist löblich; dennoch ist es im Feld der Wissenschaftstheorie, zu dem ich die Archäologie des Wissens zählen möchte, ein ungewöhnlich frivoles Spiel um ihr Zentrum der Verbindlichkeit.
[57] Habermas (1985), 130ff. Heißt es in der Theorie des kommunikativen Handelns scharf, erst diese neue Theorie vermöchte „die Strukturen einer Vernunft, auf die Adorno nur anspielt“ darzustellen (Habermas, 1988a, 524f; Hervorhebung vom Autor), und noch schärfer im Vortrag Die Philosophie als Platzhalter und Interpret über den „Negativismus von Adorno, (er würde) in einem umfassenden entwicklungslogischen Zusammenhang nur noch die Bestätigung dafür (sehen), dass sich der Zauber einer zur gesellschaftlichen Totalität aufgespreizten instrumentellen Vernunft nicht mehr lösen lässt“ (Habermas, 1983, 15), so heißt es neuerdings milder, Adorno vom Pranger des zum Defätisten Gestempelten loskettend, dass auch er, Habermas, an Adorno anknüpfen kann“, denn auch er würde doch, „mal hier, mal da, nach Spuren einer Vernunft (stochern), die zusammenführt, ohne Abstände zu tilgen, die verbindet, ohne Verschiedenes gleichnamig zu machen, die unter Fremden das Gemeinsame kenntlich macht, aber dem Anderen seine Andersheit lässt“ (Habermas, 1991, 158). – Vielleicht sollte noch daran erinnert werden, dass er in Frankfurt von 1956 bis 1959 Assistent Adornos war (Reese-Schäfer, 1991, 142).
[58] Habermas (1985), 154f.
[59] Ebd., p. 130.
[60] Ebd., p. 137f (Hervorhebung vom Autor).
[61] Vgl. den ersten Satz des Vorwortes der Schrift Der Begriff des Unbewussten…: „Aufklärung ist die Absicht dieser Arbeit, Aufklärung in doppeltem Sinne, die Aufklärung eines problematischen Begriffes zunächst, dann aber auch Aufklärung als Ziel in der umfassenderen Bedeutung, die Geschichte dem Begriff verleiht: Destruktion dogmatischer Theorien und Bildung von solchen an ihrer Stelle, die in Erfahrung gründen und für Erfahrung zweifelsfrei gewiss sind.“ (1; 81; Hervorhebung vom Autor.)
[62] Je mehr die Analyse der Dialektik der Aufklärung im Umfeld der Entstehung der Logik des Zerfalls anzusiedeln ist, um so mehr gerät sie in den Sog eines logizistischen Universalismus, wo nicht mehr gesagt werden kann, ob die Autoren ihre These aus der Gesellschaftsanalyse hergeleitet oder aus ihren Konzepten deduziert haben, und wo die Idee unvorstellbar wird, dass die Dominanz anderer Kulturen auch einen anderen Gang der Geschichte zur Folge gehabt hätte. Ein Paradox, und folglich doch keine theoretische Grundlage der Dialektik der Aufklärung? Das Paradox ist dann gelöst, wenn strikt die Erkenntnistheorie der Logik des Zerfalls, das Verhältnis von Sinn und Begriff, getrennt wird von der Geschichtsphilosophie, in der sie steht, dem Verhältnis von Natur und Geist. Unter dieser Perspektive ist zumindest der Titel der ansonsten erhellenden Arbeit, die eben die Geschichtsphilosophie Adornos visiert, falsch: Adorno – Logik des Zerfalls, Schmucker (1977).
[63] Habermas (1975).
[64] Benhabib (1992), 172.
[65] Habermas (1986), 368.
[66] Seel (1986), 53 (Hervorhebung vom Autor).
[67] Von der Kapitalismusanalyse bleibt nicht eben viel Schwung, die polizeilichen und militärischen Kasernen erscheinen als lustige Hundehütten: „Politische Herrschaft stützt sich auf ein Drohpotential, das von kasernierten Gewaltmitteln gedeckt ist; gleichzeitig lässt sie sich aber durch legitimes Recht autorisieren. Wie in der Rechtsgeltung, so verbinden sich auch in der kollektiven Verbindlichkeit politischer Entscheidungen beide Momente, Zwang und normativer Geltungsanspruch – nun aber seitenverkehrt. Während das Recht, ungeachtet seiner Positivität, von Haus aus normative Geltung beansprucht, steht die Macht, ungeachtet ihrer Autorisierung, als Mittel für die Erreichung ihrer Ziele einem politischen Willen zur Disposition. Deshalb fungiert das Recht, wenn man es empirisch betrachtet, oft nur als die Form, deren sich die politische Macht bedient. Allein diese, normativ gesehen: verkehrte Faktizität einer dem Recht externen, das Recht instrumentalisierenden und insofern illegitimen Macht ist vorerst nicht unser Thema. Der begrifflichen Analyse erschließt sich nur jene Spannung zwischen Faktizität und Geltung, mit der die politische Macht als solche aufgeladen ist, weil sie in einem internen Zusammenhang mit dem Recht steht, an dem sie sich legitimieren muss.“ (Habermas, 1992, 171; Hervorhebung vom Autor.) Für bürgerrechtliche Aktivitäten außerhalb der eigentlichen Rechtssphäre sehe ich hier keinen Spielraum mehr. Dem diskurstheoretischen Leitsatz haftet ein eigentümlicher Salonanarchismus an, der einen ob so viel Glück in der Schwatzhaftigkeit etwas ratlos macht: „Die Einheit einer vollständig prozeduralisierten Vernunft (…) gesteht keinem Konsens (…) legitimierende Kraft zu, der sich nicht unter fallibilistischem Vorbehalt und auf der Grundlage anarchisch entfesselter kommunikativer Freiheiten einspielt. Im Taumel dieser Freiheit gibt es keine Fixpunkte mehr außer dem des demokratischen Verfahrens selber – eines Verfahrens, dessen Sinn schon im System der Rechte beschlossen ist.“ (Ebd., p. 228f; Hervorhebung U. R.)
[68] Im engen Sinn als Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm aufgenommen in Habermas (1983). In einem weiteren Sinn ist die ganze Diskurstheorie Diskursethik.
[69] Habermas' Purismus bezüglich theoretischer Stringenz reizt zu Polemik und Frivolität: Der Mangel an Wertzuschreibung der Darstellungsmodalität in der Diskurstheorie korrespondiert in der repräsentativen Demokratie mit dem Mangel an Möglichkeiten des, um es theoretisch abseitig zu formulieren, Sich-selber-Einbringens; politische Diskussionen erscheinen als Hahnenkämpfe wohl informierter Sachverständiger – die Bürgerschaft schaut lernend zu. – Die Aussage: „Es muss klarwerden, dass in der kommunikativen Vernunft der Purismus der reinen Vernunft nicht wieder aufersteht“ (Habermas, 1985, 351), schließt auf einer praktischen Ebene – das ist dieselbe problematische wie bei Kant – nicht aus, dass die Kommunikationstheorie selbst wieder einem eigenen Purismus verfällt, nämlich der verklärenden Bedingungsunabhängigkeit bezüglich Herrschaftsfragen.
[70] Habermas (1988a), 103.
[71] Ebd., p. 104f (Hervorhebungen vom Autor).
[72] Ebd., p. 108f.
[73] Man soll in bedeutungsschweren Passagen zu keinen Fehltritten in die Polemik ansetzen; trotzdem: Habermas fordert die Polemik geradezu hochmütig heraus und damit die Meinung, er hätte den Diskurs annektiert und es könne nur noch im Doppelsinn über die Zensurstelle Habermas gesprochen werden. Der propositionale Gehalt, der die Rationalität in moralisch-politischen Fragen in letzter Instanz gewährt und um den sich alle Ausdrucksmodalitäten wie Wahrheit, Norm und Schönheit gruppieren müssen – es ist Habermas' Werk selbst.